Facharzt des Artikels
Neue Veröffentlichungen
Auswirkungen von Ramipril bei Patienten mit Typ-2-Diabetes mellitus und arterieller Hypertonie
Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
Diabetes mellitus (DM) zählt zu den häufigsten Erkrankungen der modernen Welt. Typ-2-Diabetes dominiert mit rund 250 Millionen Patienten. Arterielle Hypertonie (AH) tritt bei etwa 80 % der Patienten mit Typ-2-Diabetes auf. Die Komorbidität dieser beiden miteinander verbundenen Erkrankungen erhöht die Inzidenz vorzeitiger Behinderungen und die Mortalität durch kardiovaskuläre Komplikationen signifikant. Daher hat die Korrektur des Blutdrucks (BP) bei der Behandlung von Patienten mit Diabetes Priorität. Unter den modernen blutdrucksenkenden Mitteln sind Angiotensin-Converting-Enzym-Hemmer (ACEI) die wohl am besten erforschte Medikamentenklasse.
Tatsächlich wird derzeit die führende Rolle in der Pathogenese der arteriellen Hypertonie bei Patienten mit Typ-2-Diabetes mellitus der Aktivierung des sympathisch-adrenalen und des Renin-Angiotensin-Systems (RAS) zugeschrieben. Das wichtigste Effektorhormon des RAS ist Angiotensin, das eine starke vasokonstriktorische Wirkung hat, die Rückresorption von Natrium und Wasser sowie die sympathische und adrenale Aktivität erhöht und nicht nur funktionelle, sondern auch strukturelle Veränderungen im Myokard- und Gefäßgewebe reguliert.
Die pharmakologische Wirkung von ACE beruht auf der Hemmung der Aktivität des Angiotensin-I-Converting-Enzyms (oder Kininase II) und damit auf der funktionellen Aktivität des RAS- und Kallikrein-Kinin-Systems. Durch die Hemmung des Angiotensin-I-Converting-Enzyms reduzieren ACE-Hemmer die Bildung von Angiotensin II und schwächen dadurch die wichtigsten kardiovaskulären Effekte des RAS, einschließlich arterieller Vasokonstriktion und Aldosteronsekretion.
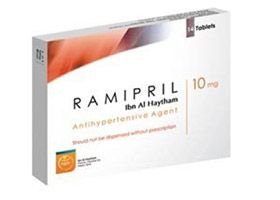 Einer der ACE-Hemmer ist Ramipril (Polapril, Polpharma Pharmaceutical Works SA; Actavis hf; Actavis Ltd., Polen/Island/Malta), das im Gegensatz zu anderen Arzneimitteln dieser Gruppe die Häufigkeit von Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskulärem Tod bei Patienten mit erhöhtem kardiovaskulären Risiko aufgrund von Gefäßerkrankungen (ischämische Herzkrankheit, früherer Schlaganfall oder periphere Gefäßerkrankung) oder Diabetes mellitus, die mindestens einen zusätzlichen Risikofaktor aufweisen (Mikroalbuminurie, arterielle Hypertonie, erhöhter Gesamtcholesterinspiegel, niedriges High-Density-Lipoprotein, Rauchen), die Gesamtmortalität und die Notwendigkeit von Revaskularisierungsverfahren senkt und den Beginn und das Fortschreiten einer chronischen Herzinsuffizienz verlangsamt. Sowohl bei Patienten mit als auch ohne Diabetes mellitus reduziert Ramipril eine bestehende Mikroalbuminurie und das Risiko einer Nephropathie signifikant.
Einer der ACE-Hemmer ist Ramipril (Polapril, Polpharma Pharmaceutical Works SA; Actavis hf; Actavis Ltd., Polen/Island/Malta), das im Gegensatz zu anderen Arzneimitteln dieser Gruppe die Häufigkeit von Herzinfarkt, Schlaganfall und kardiovaskulärem Tod bei Patienten mit erhöhtem kardiovaskulären Risiko aufgrund von Gefäßerkrankungen (ischämische Herzkrankheit, früherer Schlaganfall oder periphere Gefäßerkrankung) oder Diabetes mellitus, die mindestens einen zusätzlichen Risikofaktor aufweisen (Mikroalbuminurie, arterielle Hypertonie, erhöhter Gesamtcholesterinspiegel, niedriges High-Density-Lipoprotein, Rauchen), die Gesamtmortalität und die Notwendigkeit von Revaskularisierungsverfahren senkt und den Beginn und das Fortschreiten einer chronischen Herzinsuffizienz verlangsamt. Sowohl bei Patienten mit als auch ohne Diabetes mellitus reduziert Ramipril eine bestehende Mikroalbuminurie und das Risiko einer Nephropathie signifikant.
Ziel der Studie war es, die klinischen, hämodynamischen und biochemischen Effekte einer 12-wöchigen Einnahme von Ramipril bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und arterieller Hypertonie zu untersuchen.
Die Studie umfasste 40 Patienten (25 Frauen und 15 Männer) – die Hauptgruppe – über 50 Jahre mit arterieller Hypertonie und Typ-2-Diabetes mellitus. Ausschlusskriterien waren schwere unkontrollierte arterielle Hypertonie (Blutdruck > 200/110 mmHg), schwere Lebererkrankungen, akuter Schlaganfall oder akuter Myokardinfarkt innerhalb der letzten 6 Monate, instabile Angina pectoris, Herzinsuffizienz und das Vorliegen von mikrovaskulären Komplikationen des Diabetes mellitus im Endstadium.
Alle Patienten mit arterieller Hypertonie und Diabetes mellitus Typ 2 erhielten Ramipril zur Therapie. Die Therapie dauerte 12 Wochen. Die Anfangsdosis von Ramipril betrug 2,5 mg. Die Dosis der Medikamente wurde alle zwei Wochen gemäß dem Standardschema titriert. Die Kontrollgruppe bestand aus 25 praktisch gesunden Personen. Die Diagnose von Hypertonie und Diabetes mellitus wurde gemäß den geltenden Kriterien überprüft.
Die Untersuchung der Indikatoren wurde vor und nach der Behandlung durchgeführt.
Die Untersuchung des strukturellen und funktionellen Zustands des Myokards mittels Echokardiographie und Doppler-Echokardiographie erfolgte mit dem Gerät Ultima pro 30 (Holland) im M-modalen und zweidimensionalen Modus in standardmäßigen echokardiographischen Positionen. Die Wandstärke und Abmessungen der Höhle des linken Ventrikels (LV) wurden aus der parasternalen Position der LV-Achse im M-Modus mit einem Ultraschallstrahl parallel zur kurzen Achse des LV bestimmt. Die folgenden Parameter wurden bestimmt: Auswurffraktion (EF, %), enddiastolische und endsystolische Größe (EDS und EDS) des LV in cm, enddiastolische und endsystolische Volumina (EDV und ESV) des LV. Die Masse des LV-Myokards wurde mit der folgenden Formel berechnet:
LVMM = 1,04 [(LVS + LVSD + EDR)3 -- (EDR)3] - 13,6,
Dabei ist 1,04 die Myokarddichte (in g/cm2) und 13,6 der Korrekturfaktor in Gramm.
Alle Patienten wurden einer 24-Stunden-Blutdruckmessung (ABDM) (Meditech, CardioTens) unterzogen. Abhängig vom Wert des 24-Stunden-Index wurden folgende Patientengruppen unterschieden: „Dipper“ – 10–22 %, „Non-Dipper“ – < 10 %, „Over-Dipper“ – ≥ 22 %, „Night-Peaker“ – negativer Wert des 24-Stunden-Index. Die oberen Normgrenzen für die Variabilität des systolischen Blutdrucks tagsüber und nachts lagen bei 15,7 bzw. 15,0 mmHg, der diastolische bei 13,1 bzw. 12,7 mmHg.
Die Bestimmung des Gehalts an glykosyliertem Hämoglobin (HbAlc) im Vollblut erfolgte mittels einer photometrischen Methode unter Verwendung einer Reaktion mit Thiobarbitursäure unter Verwendung eines kommerziellen Testsystems der Firma Reagent (Ukraine) gemäß der beigefügten Anleitung.
Der Glukosespiegel wurde mittels Glukoseoxidationsmethode in Kapillarblut auf nüchternen Magen bestimmt. Der normale Glukosespiegel lag bei 3,3–5,5 mmol/l.
Der Insulinspiegel im Blutserum wurde mittels Enzymimmunoassay mit dem ELISA-Kit (USA) bestimmt. Der erwartete Insulinwertbereich liegt normalerweise bei 2,0–25,0 μU/ml.
Die Bestimmung des Gesamtcholesterins (TC), der Triglyceride (TG), des High-Density-Lipoprotein-Cholesterins (HDL-C), des Low-Density-Lipoprotein-Cholesterins (LDL-C), des Very-Low-Density-Lipoprotein-Cholesterins (VLDL-C) und des atherogenen Index (AI) erfolgte im Blutserum mit der enzymatischen photokolorimetrischen Methode unter Verwendung von Kits der Firma „Human“ (Deutschland).
Der Resistin- und Adiponektingehalt im Blutserum der Patienten wurde mittels Enzymimmunoassay auf dem Enzymimmunoassay-Analysator „Labline-90“ (Österreich) bestimmt. Der Resistinspiegel wurde mit einem kommerziellen Testsystem der Firma „BioVendor“ (Deutschland) bestimmt; der Adiponektinspiegel mit einem kommerziellen Testsystem der Firma „ELISA“ (USA).
Zur statistischen Aufbereitung der gewonnenen Daten wurden das Computerprogramm „Statistics 8.0“ (Stat Soft, USA) und die Methode der Variationsstatistik (Student-Kriterium) verwendet; der Zusammenhang zwischen den Merkmalen wurde mittels Korrelationsanalyse beurteilt.
In der vorläufigen Analyse unterschieden sich die anthropometrischen (Körpergewicht, BMI, Taillen- und Hüftumfang), hämodynamischen (SBP und DBP, HR, Puls) und biochemischen Indizes des Kohlenhydratstoffwechsels in der Gruppe vor und nach der Behandlung nicht signifikant (p> 0,05). Auf dieser Grundlage kann festgestellt werden, dass die Wirkung der untersuchten medikamentösen Therapiemethode vor einem identischen Hintergrund erzielt wurde.
Der HDL-C-Spiegel stieg signifikant um 4,1 % (p < 0,05), was wahrscheinlich auf einen verminderten Abbau dieser Lipoproteine zurückzuführen ist. Es wurde eine Abnahme des TG-Gehalts um 15,7 % (p < 0,05) und des LDL-Gehalts um 17 % (p < 0,05) festgestellt, was auf eine erhöhte Insulinempfindlichkeit des Gewebes und eine verminderte Hyperinsulinämie zurückzuführen sein könnte, die maßgeblich die Geschwindigkeit der Bildung und des Stoffwechsels dieser Lipide im Körper bestimmen. Andere Indikatoren des Lipidstoffwechsels veränderten sich nicht signifikant.
Bei der Untersuchung der Dynamik des Adipozytokonstoffwechsels vor dem Hintergrund der Ramipril-Therapie wurde eine signifikante Abnahme des Resistinspiegels um 10 % und eine Zunahme des Adiponektinspiegels um 15 % festgestellt (p < 0,05). Dies lässt sich dadurch erklären, dass Resistin als Mediator der Insulinresistenz gilt und seine Abnahme möglicherweise mit einer erhöhten Insulinsensitivität des Gewebes einhergeht.
Die Ramipril-Therapie führte zu einer signifikanten Verringerung der Wanddicke, Masse und Größe des linken Ventrikels (p < 0,05) und einer Erhöhung der myokardialen Kontraktilität um 2,3 % (p < 0,05).
Laut ABPM-Daten entsprach der anfängliche durchschnittliche Blutdruckwert einer Hypertonie im Stadium 2. Es wurde ein Anstieg des Pulsblutdrucks und der systolischen Blutdruckvariabilität tagsüber festgestellt, die unabhängige Risikofaktoren für kardiovaskuläre Komplikationen darstellen. Unter den untersuchten Patienten befanden sich 16 Patienten mit einem erhöhten Blutdruckwert, 14 Patienten mit einem erhöhten Blutdruckwert, 6 Patienten mit einem erhöhten Blutdruckwert und 4 Patienten mit einem erhöhten Blutdruckwert in der Nacht. Es ist zu beachten, dass eine unzureichende Blutdrucksenkung während der Nacht ein bestätigter Risikofaktor für die Entwicklung kardiovaskulärer und zerebrovaskulärer Komplikationen ist.
Während der ABPM zeigte sich eine Normalisierung des durchschnittlichen täglichen systolischen und diastolischen Blutdrucks. Die Zielblutdruckwerte wurden bei 24 (60 %) Patienten erreicht. Darüber hinaus verringerte sich durch die Behandlung die Druckbelastung und die Variabilität des systolischen Blutdrucks während der Tagesstunden normalisierte sich. Der Pulsblutdruckwert während der Tagesstunden, der die Steifheit der Hauptarterien widerspiegelt und ein unabhängiger kardiovaskulärer Risikofaktor ist, normalisierte sich nach 12 Wochen.
Die Ramipril-Therapie wirkte sich auch positiv auf den zirkadianen Rhythmus des Blutdrucks aus. Die Zahl der Patienten mit einem normalen zirkadianen Index (Dipper) stieg auf 23, und die Zahl der Patienten mit überwiegend nächtlichem Blutdruckanstieg (Night-Peaker) sank auf 2. Fälle eines übermäßigen nächtlichen Blutdruckabfalls (Over-Dipper) wurden nicht registriert.
Die erhaltenen Ergebnisse bestätigen die Wirksamkeit von Ramipril in einer Dosis von 10 mg/Tag bei der Behandlung von leichter und mittelschwerer arterieller Hypertonie bei Patienten mit Typ-2-Diabetes. Die Therapie war wirksam, die Blutdruckzielwerte wurden in 24 Stunden (60 %) erreicht. Darüber hinaus hatte Ramipril eine günstige Wirkung auf die 24-Stunden-Blutdruckparameter, die als kardiovaskuläre Risikofaktoren gelten, insbesondere bewirkte es eine Senkung des Druckbelastungsindex und eine Normalisierung der systolischen Blutdruckvariabilität im Tagesverlauf. Letzterer Parameter erhöht das Risiko von Zielorganschäden und korreliert positiv mit der Myokardmasse und abnormer LV-Geometrie sowie dem Resistinspiegel. Die Parameter des zirkadianen Blutdruckrhythmus, dessen Störung bei Patienten mit Typ-2-Diabetes mit einem mehr als 20-fach erhöhten Risiko eines kardiovaskulären Todes verbunden ist, verbesserten sich signifikant. Die Normalisierung des Pulsdrucks im Tagesverlauf vor dem Hintergrund der Therapie weist auf eine Verbesserung der elastischen Eigenschaften der Wände großer Gefäße hin und spiegelt die positive Wirkung des Arzneimittels auf vaskuläre Umbauprozesse wider.
Nach 12 Wochen zeigte sich eine deutliche Verbesserung des Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsels, was natürlich zusätzlich zur Reduzierung des kardiovaskulären Risikos beiträgt.
Somit erfüllt Ramipril alle Anforderungen an blutdrucksenkende Medikamente und sorgt nicht nur für eine ausreichende tägliche Blutdruckkontrolle, sondern hat auch einen positiven metabolischen Effekt, der zu einer deutlichen Verringerung des Risikos der Entwicklung und des Fortschreitens kardiovaskulärer Komplikationen führt.
Daher können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden.
Vor dem Hintergrund der Therapie mit Ramipril wurden signifikante Verbesserungen des Kohlenhydrat-, Lipid- und Adipozytokinstoffwechsels beobachtet.
Die Ramipril-Therapie bei Patienten mit arterieller Hypertonie und Typ-2-Diabetes mellitus führte zu einer signifikanten Blutdrucksenkung im Tagesverlauf, einer Normalisierung des Druckbelastungsindexes tagsüber und nachts sowie des gestörten zweiphasigen Blutdruckprofils und einer signifikanten Senkung der systolischen Blutdruckvariabilität im Tagesverlauf. Die Anwendung von Ramipril geht mit einer geringen Nebenwirkungsrate einher, was die Therapietreue und -wirksamkeit erhöht.
Prof. PG Kravchun, OI Kadykova. Auswirkungen von Ramipril bei Patienten mit Typ-2-Diabetes mellitus und arterieller Hypertonie // International Medical Journal - Nr. 3 - 2012
 [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]
[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]
Wen kann ich kontaktieren?

