Facharzt des Artikels
Neue Veröffentlichungen
HPV-Typ 56
Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
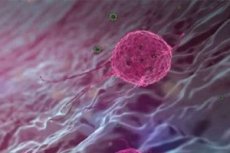
Auf der Erde gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensformen. Einige dieser Formen sind so mikroskopisch klein, dass man sie mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Ein Beispiel hierfür ist das extrem verbreitete Papillomavirus, das nur mit einem hochauflösenden Mikroskop sichtbar ist, da die Größe seines Virions im Durchschnitt nur 30 nm beträgt. Das Papillomavirus (HPV) hat mehr als 100 Typen (einigen Quellen zufolge etwa 600) und ist trotz seiner geringen Größe nicht so harmlos, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Einige Virustypen, beispielsweise HPV Typ 56, können beim Menschen tödliche Krebserkrankungen auslösen. Dies ist bereits ein Grund, mehr über das Virus zu erfahren, um traurige Folgen rechtzeitig zu verhindern.
HPV 56 ist ein onkogener Typ des humanen Papillomavirus. Obwohl dieser Stamm zusammen mit einigen anderen (HPV 30, 35, 45, 53 usw.) als Virus mit durchschnittlichem onkogenem Risiko gilt, sollte er nicht leichtfertig behandelt werden. Schließlich bleibt die Wahrscheinlichkeit, vor dem Hintergrund des Papillomavirus an Krebs zu erkranken, recht hoch, und je länger das Virus im Körper aktiv bleibt, desto höher ist das Krebsrisiko.
Wir haben die häufig gestellte Frage beantwortet: Ist HPV Typ 56 gefährlich? Da die Antwort positiv ist, ist es notwendig, diesen Virustyp genauer zu betrachten, um zu verstehen, was er ist, wie er auf den Menschen übertragen wird, wie man sein Vorhandensein im Körper diagnostiziert und die negativen Auswirkungen des Virus auf die menschliche Gesundheit minimiert.
Struktur HPV-Typ 56
Von den 600 angeblich in der Natur vorkommenden HPV-Stämmen können mehr als 100 den menschlichen Körper befallen. Nicht alle Virustypen sind für den Menschen gefährlich, und viele verursachen keinerlei Auffälligkeiten und zeigen keine äußeren Erscheinungen. HPV Typ 56 gehört jedoch nicht zu den sicheren Virustypen, und obwohl es sich möglicherweise eine Zeit lang nicht manifestiert, besteht das Risiko, dass das Virus irgendwann aktiv wird und zu pathologischen Veränderungen in der Struktur und Funktion der Körperzellen führt.
Unabhängig von Virustyp und -art sind die Virionen Mikropartikel, deren Größe zwischen 20 und 300 nm variieren kann. HPV Typ 56 ist einer der Papillomavirustypen mit der geringsten Virionengröße. Der Durchmesser der Papillomaviruszelle beträgt etwa 30–55 nm, wodurch das Virus leicht durch Mikroschäden in menschlicher Haut und Schleimhäuten eindringen kann. Da die Schleimhäute eine lockerere Struktur aufweisen, ist eine Infektion mit dem Papillomavirus bei Schleimhautkontakt, auch beim Geschlechtsverkehr, wahrscheinlicher, was zahlreiche Studien bestätigen. Bei sexuellem Kontakt ist der Kontakt länger und enger, was die Ansteckungswahrscheinlichkeit erhöht.
Eine Besonderheit des Papillomavirus besteht darin, dass seine Partikel nicht vom Tier auf den Menschen übertragen werden, d. h. die Infektionsquelle ist immer ein Mensch, in dessen Körper sich ein aktives Virus befindet.
HPV-Virionen sind Mikropartikel, die aus einem Kern und einem Kapsid (Proteinhülle) bestehen, denen jedoch die für größere Viren charakteristische Membranhülle fehlt. Um zu überleben und sich zu vermehren, benötigt eine solche Viruszelle eine Wirtszelle, die ihre Eigenschaften durch das aktive Leben des Virus verändert.
Der Genotyp oder das Genom des HPV-Typs 56 mit mittlerer Onkogenität ähnelt Stämmen mit geringem und hohem onkogenem Risiko und wird durch ein doppelsträngiges zirkuläres DNA-Molekül repräsentiert. Mit anderen Worten gehört das Papillomavirus zu den DNA-haltigen Viren (insgesamt gibt es bei Wirbeltieren, einschließlich des Menschen, 11 Familien solcher Erreger), die am häufigsten verschiedene menschliche Krankheiten verursachen. In diesem Fall wird die DNA des Virions direkt in der infizierten Zelle synthetisiert, wobei diese als eine Art Kokon dient, der den während des Syntheseprozesses gebildeten neuen Virionen Schutz und Nahrung bietet. Der Prozess der Zellreplikation oder -teilung findet statt, wodurch ein Tochtermolekül mit einer Kopie des DNA-Moleküls auf der Matrix des Muttermoleküls synthetisiert wird.
Das HPV-Genom besteht aus drei differenzierten Regionen mit spezifischen Funktionen: den frühen und späten Regionen E und L sowie der Kontrollregion LCR. Letztere erfüllt viele Funktionen, darunter die Replikation des viralen Genoms, die DNA-Transkription und die Zelltransformation unter dem Einfluss der in onkogenen Virionen produzierten Onkoproteine E6 und E7.
HPV Typ 56 gilt als Virus mit mittlerer Onkogenität. Dies bedeutet, dass Onkoproteine in solchen Zellen in geringeren Mengen produziert werden und zusätzliche Bedingungen erforderlich sind, damit sie eine Deformation der Wirtszellen verursachen (in den meisten Fällen handelt es sich dabei um eine deutlich reduzierte Immunität und eine erbliche Veranlagung für Krebs).
Lebenszyklus HPV-Typ 56
Obwohl Papillomaviruszellen eine sehr einfache Struktur aufweisen, handelt es sich bei ihnen um lebende Mikroorganismen, die in ihrer Entwicklung einen bestimmten Lebenszyklus durchlaufen. Das Virus selbst kann außerhalb eines lebenden Organismus nicht aktiv existieren. Daher muss es für seine vollständige Existenz und Vermehrung in eine lebende Zelle, in diesem Fall in menschliche Epidermiszellen, eindringen.
Trotz ihrer mikroskopischen Größe dringen HPV 56 und andere Typen selten tiefer als die Epidermis ein. Daher sind die Wirtszellen für die Virionen die oberflächlichen Zellen der Haut und des Epithels der Schleimhäute – Keratozyten. Der Lebenszyklus von HPV ist an die Entwicklungsstadien der Hauptzellen der Epidermis gebunden. Wir sprechen vom Programm der zellulären Differenzierung der Wirtszelle. Eine Infektion erfolgt, wenn die Papillomavirus-Virionen die an die Dermis grenzende Basalschicht der Epidermis erreichen, wo junge Keratozyten synthetisiert werden und sich aktiv teilen. Diese Wahl ist nicht zufällig, da diese Keratozyten ein großes Potenzial zur Differenzierung und zum Erwerb spezifischer Funktionen haben.
Onkogene Virustypen integrieren sich vollständig in das Genom der Wirtszelle und verändern deren Eigenschaften und Verhalten. Solche Zellen neigen zu unkontrollierter Vermehrung und verursachen dysplastische Prozesse in Haut und Schleimhäuten, die sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von gutartig zu bösartig entwickeln können. Gleichzeitig beginnen die Viruszellen nicht unmittelbar nach dem Eindringen in die Epidermis mit der Replikation (Teilung). Sie erhalten den Genotyp, indem sie lediglich eine kleine Anzahl von Kopien chromosomaler DNA-Abschnitte mit einem entsprechenden Gensatz bilden (Amplifikation). Dies ist die sogenannte Inkubationszeit des Virus, die von zwei Wochen bis zu mehreren Jahren dauern kann.
Während des Reifungs- und Differenzierungsprozesses verlagern sich reifere Keratinozyten in die subbasale Schicht und höher an die Hautoberfläche. Dort, wo sich infizierte Keratinozyten befinden, findet die Proteinsynthese und Replikation von HPV-Virionen statt. Mithilfe von Nährstoffen und Proteinen der Wirtszelle können sich Virionen vermehren. Infolgedessen kommt es zu ungeplanten Teilungen der Wirtszelle. Eine Zunahme solcher Teilungen im Zuge der Virusvermehrung führt zur Entstehung und Entwicklung von Tumorprozessen, denen das geschwächte Immunsystem nicht gewachsen ist.
Eine Malignität (Malignität der Zellen) unter dem Einfluss von HPV Typ 56 tritt in der Regel auf, wenn der Körper das Virus 6-12 Monate lang nicht alleine bewältigen kann. Dies führt zu einer chronischen Virusbeladung, die das menschliche Immunsystem erheblich schwächt. Und eine schwache Immunität ist eine der Hauptbedingungen für die Aktivierung des Virus und die Entwicklung bösartiger Erkrankungen.
Andererseits erleichtert eine starke Immunität die Eliminierung (Entfernung) von Viruspartikeln aus dem Körper, noch bevor diese sich in das Genom menschlicher Zellen integrieren können.
Um zu verstehen, wie HPV 56 von Mensch zu Mensch übertragen wird, muss man wissen, dass die geringe Größe der Papillomavirus-Virionen es ihnen ermöglicht, in jeden Mikroschaden der Haut einzudringen. Und selbst wenn äußerlich keine Hautschäden sichtbar sind, bedeutet dies nicht, dass überhaupt keine vorhanden sind und der Weg für das Virus versperrt ist. Eine Untersuchung der Haut und der Schleimhäute unter dem Mikroskop zeigt, dass ein Mensch im Laufe des Tages viele Mikroschäden (Mikrorisse, Kratzer, Einstiche) erleidet, die er nicht einmal ahnt, sodass der Kontakt mit einer infizierten Person potenziell gefährlich ist.
Jede Schädigung der menschlichen Haut stellt für Papillomaviren jeglicher Art einen direkten Weg in den Körper dar. In der Regel handelt es sich dabei um mehrere HPV-Typen gleichzeitig, die gleichzeitig oder getrennt in den menschlichen Körper eindringen.
Für HPV Typ 56 ist der häufigste Infektionsweg der sexuelle Weg, d. h. die Virionen werden beim Geschlechtsverkehr durch kleine Verletzungen der empfindlichen Schleimhaut der äußeren oder inneren Geschlechtsorgane übertragen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass andere mögliche Infektionswege ausgeschlossen werden sollten, beispielsweise die Übertragung des Virus von der Mutter auf den Fötus während dessen Passage durch den Geburtskanal oder eine Kontaktinfektion, wenn die Haut an der Kontaktstelle verletzt wurde.
Die Wahrscheinlichkeit, sich beim Geschlechtsverkehr mit dem Virus zu infizieren, ist jedoch deutlich höher. Dies muss insbesondere bei krebserregenden Viren beachtet werden. Wichtig ist zu verstehen, dass das Eindringen des Virus in den Körper nicht zwangsläufig zu einer Erkrankung führt. In vielen Fällen ist der menschliche Körper in der Lage, das Virus selbstständig zu bekämpfen und dessen Aktivität und Vermehrung zu verhindern.
Es gibt bestimmte Faktoren, die das Krebsrisiko bei Kontakt mit HPV 56 oder einem anderen onkogenen Stamm erhöhen. Zu diesen Faktoren gehören:
- schwache Immunität oder aus dem einen oder anderen Grund geschwächt (Immunsuppression),
- Immunschwächezustände, wie Immunsuppression bei Patienten mit HIV-Infektion,
- das Vorhandensein sexuell übertragbarer Infektionen, die die lokale Immunität unterdrücken,
- ein Mangel an Vitaminen und Mikroelementen im Körper, der die Durchlässigkeit der Haut erhöht und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen verringert,
- genetische oder erbliche Veranlagung, wenn es in der Familie bereits Fälle von Onkologie gab,
- Schwangerschaft (aufgrund der Umstrukturierung des Körpers der Frau wird er empfindlicher gegenüber den Auswirkungen negativer Faktoren),
Darüber hinaus gibt es Faktoren, die die Schutzfunktionen des Körpers auf der Ebene des zentralen Nervensystems schwächen können. Dies sind Überarbeitung, ständiger Stress, schlechte Gewohnheiten (Rauchen, Drogen- und Alkoholkonsum) und die Einnahme psychoaktiver Medikamente.
Die Wahrscheinlichkeit einer HPV-Infektion ist bei Menschen mit fragwürdigem Lebensstil höher. Gelegenheitssex mit unterschiedlichen Sexualpartnern, mangelnde Gesundheitsfürsorge und mangelnde Intimhygiene tragen nicht nur zur HPV-Infektion bei, sondern auch zur Verbreitung des Virus zwischen Menschen.
 [ 9 ]
[ 9 ]
Symptome
Es ist schwer zu sagen, wann sich HPV nach dem Eindringen in den menschlichen Körper bemerkbar macht. Viel hängt vom Zustand des Immunsystems ab. Deshalb ist die Inkubationszeit des Virus so unklar, und nur 10 von 100 Menschen entwickeln Krankheitssymptome. Gleichzeitig ist der Einfluss der oben genannten Risikofaktoren groß. Der Körper der restlichen 90 % bewältigt das Virus innerhalb weniger Jahre selbstständig.
Onkogene HPV-Typen, darunter HPV 56, befallen vor allem die menschlichen Fortpflanzungsorgane. Sowohl Frauen als auch Männer können sich gleichermaßen mit dem Virus infizieren, wenn Mikroschäden an Haut oder Schleimhäuten vorliegen. Besonders häufig kommt es beim Geschlechtsverkehr zu einer Ansteckung.
 [ 10 ]
[ 10 ]
HPV Typ 56 bei Männern
Die Auswirkungen des Papillomavirus auf das männliche und weibliche Fortpflanzungssystem sind jedoch unklar. HPV 56 verursacht bei Männern keinen Krebs, kann aber, wenn auch selten, gesundheitsgefährdende oder lebensbedrohliche Zustände hervorrufen. Ein für HPV charakteristisches spezifisches Symptom wie Genitalwarzen (Kondylome) ist bei Männern äußerst selten.
Noch seltener wird HPV Typ 56 bei Männern mit bowenoider Papulose nachgewiesen, die durch das Auftreten von erythematösen Flecken, Papeln und Plaques auf der Haut der Genitalien gekennzeichnet ist. Ärzte gehen jedoch davon aus, dass diese Krankheit, eine präkanzeröse Erkrankung, durch das Papillomavirus, genauer gesagt seine onkogenen Stämme, ausgelöst wird.
In Einzelfällen kann sich vor dem Hintergrund einer HPV 56-Infektion Morbus Bowen entwickeln, d. h. intraepidermaler Krebs mit seinen charakteristischen leuchtend roten Neoplasien mit gezackten Rändern, auch auf der Haut des Penis. Bowenoide Papulose und Morbus Bowen werden üblicherweise mit hoch onkogenen Viren und insbesondere den HPV-Typen 16 oder 18 in Verbindung gebracht. Bei Vorhandensein von Risikofaktoren kann jedoch auch die aktive Reproduktion von HPV 56 zu solchen Folgen führen. Ob Sie diese Theorie anhand Ihrer eigenen Erfahrung testen, entscheidet jeder für sich.
Bei einem deutlich geschwächten Immunsystem ist mit einer Ausbreitung des Virus über den Intimbereich hinaus zu rechnen. Im Analbereich, in und um die Achselhöhlen, an Hals, Brust, Händen und Füßen können sich weiche, fleischfarbene Wucherungen in Form von Papillen bilden. Es besteht auch die Gefahr, dass das Virus in die Harnröhre eindringt. Bilden sich dort spezifische Wucherungen, können Probleme beim Wasserlassen auftreten.
Das Auftreten neuer Wucherungen auf der Haut geht nicht mit Schmerzen einher, obwohl Männer manchmal über Juckreiz (meist im Intimbereich) klagen. Leichte Schmerzen und Blutungen können auftreten, wenn Kondylome beschädigt sind, was am häufigsten beim Geschlechtsverkehr oder bei Hygienemaßnahmen auftritt.
Die oben beschriebenen Symptome können als präkanzeröse Zustände angesehen werden, da jegliche Neoplasien eine Folge der Aktivierung des Virus sind. Und obwohl HPV Typ 56 selbst keinen Krebs auslöst, können sich gutartige Wucherungen bei Vorhandensein von Risikofaktoren zu bösartigen entwickeln. Daher sollte der Zusammenhang zwischen HPV 56 und Krebs nicht verneint werden, auch wenn solche Fälle in der Praxis sehr selten sind und es schwierig ist festzustellen, welcher der beim Patienten nachgewiesenen onkogenen Stämme für die Krebsentstehung verantwortlich ist.
HPV Typ 56 bei Frauen
Bei Frauen, die mit dem onkogenen Virus infiziert sind, ist die Situation noch ungünstiger. Das Risiko äußerer Infektionssymptome in Form von Warzen und Kondylomen ist deutlich höher (8 von 10 Patientinnen). Darüber hinaus reduziert HPV 56 bei Frauen die lokale Immunität erheblich, was zur Entwicklung bakterieller, pilzlicher und einiger viraler Infektionen führt, für die die Bedingungen der weiblichen Vagina ein optimales Umfeld für Lebensraum, Entwicklung und Fortpflanzung bieten.
Es ist nicht überraschend, dass viele Symptome der Aktivierung einer Papillomavirus-Infektion den Manifestationen vieler Erkrankungen des weiblichen Intimbereichs ähneln:
- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr,
- Schmerzen im Unterbauch,
- blutiger Ausfluss nach dem Geschlechtsverkehr,
- Juckreiz im Intimbereich,
- Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen.
Das auffälligste Symptom des Papillomavirus ist jedoch das Auftreten spezifischer spitzer Wucherungen im Analbereich und an den Genitalien (Klitoris, kleine und große Schamlippen, Vaginalfalten, die der Arzt bei einer gynäkologischen Untersuchung auf dem Stuhl sieht). Solche Wucherungen können eine Farbe von hautfarben bis rosa oder braun haben. Sie haben eine weiche Textur und einen Stiel, der an der Haut haftet, sich zu Gruppen zusammenschließen und recht schnell wachsen kann. In diesem Fall kann das Wachstum in zwei Richtungen erfolgen: über der Hautoberfläche und in der Haut, was bei der Entfernung Probleme bereitet.
All dies ist sehr unangenehm und kann zu gewissen Schwierigkeiten im Intimleben führen, stellt jedoch keine Gefahr für das Leben einer Frau dar. Eine andere Sache ist, dass dysplastische Prozesse im Epithel mit einer Abnahme der Immunität und der Ansammlung geschädigter Zellen kritische Ausmaße annehmen können. Eine Dysplasie der Gebärmutter oder ihres Gebärmutterhalses gilt bereits als Krebsvorstufe und kann sich unter bestimmten Umständen (z. B. bei genetischer Veranlagung oder langem Verlauf) zu Gebärmutterkrebs entwickeln.
Auch hier ist das Risiko eines solchen Verlaufs höher, wenn eine Infektion mit HPV-Stämmen eines stark onkogenen Typs vorliegt, aber selbst ein Virus mit mäßiger Onkogenität kann unter bestimmten Umständen Dysplasie und später Gebärmutterkrebs verursachen.
 [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]
[ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]
HPV 56 und Myome
Häufige weibliche Pathologien wie Erosion und ihre Folge, die zervikale Dysplasie, werden häufig mit dem humanen Papillomavirus in Verbindung gebracht. Eine weitere häufige Erkrankung des weiblichen Fortpflanzungssystems ist das Uterusmyom. Daher stellen sich viele Frauen die berechtigte Frage: Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Papillomavirus und der Bildung eines gutartigen Tumors namens Myom?
Es sei darauf hingewiesen, dass die Ursachen für die Entstehung eines solchen Tumors noch nicht vollständig erforscht sind, es wurde jedoch ein Zusammenhang zwischen Tumorwachstum und der Produktion weiblicher Hormone festgestellt. In der wissenschaftlichen Literatur finden sich keine Erwähnungen von HPV im Zusammenhang mit Myomen, d. h. das Papillomavirus gilt nicht als einer der Faktoren, die das Auftreten oder Wachstum eines Tumors provozieren. Darüber hinaus ist ein Myom eine Neubildung in der Muskelschicht des Organs, während das Papillomavirus hauptsächlich in der Epidermisschicht parasitiert.
 [ 19 ]
[ 19 ]
Schwangerschaft mit HPV Typ 56 bei Frauen
Wir haben bereits festgestellt, dass eine Schwangerschaft einer der Risikofaktoren für eine Infektion und Aktivierung des Papillomavirus im Körper einer Frau ist. Hormonelles Ungleichgewicht und eine verminderte allgemeine Immunität führen zu einer erhöhten Empfindlichkeit des Körpers der werdenden Mutter gegenüber verschiedenen Infektionen. Dazu gehört das weit verbreitete Papillomavirus, das sowohl während als auch vor der Schwangerschaft in den Körper einer Frau eindringen und vor dem Hintergrund geschwächter Abwehrkräfte aktiv werden kann.
Es ist wichtig zu verstehen, dass das Vorhandensein des Virus im Körper einer Frau kein Hindernis für die Empfängnis und Geburt eines Kindes darstellt, aber die Bildung spezifischer Wucherungen an den Genitalien und deren Wachstum können Probleme verursachen. Kondylome können während der Geburt beschädigt werden und Blutungen verursachen. Das Risiko einer Infektion des Kindes mit dem Papillomavirus steigt während der Passage durch den Geburtskanal. Es besteht das Risiko, dass das Neoplasma bösartig wird.
Und das ist noch nicht alles. Feigwarzen können sich auf den After und die Harnröhre ausbreiten und so das normale Wasserlassen und den Stuhlgang beeinträchtigen, die bei schwangeren Frauen ohnehin schon beeinträchtigt sind.
Multiple Kondylome verringern die Elastizität der Wände der inneren Geschlechtsorgane einer Frau, was zu Blutungen beim Geschlechtsverkehr und während der Geburt führen kann. In besonders schweren Fällen ist sogar ein Kaiserschnitt erforderlich, um Komplikationen während der Geburt zu vermeiden.
Eine Infektion eines Babys mit Papillomaviren während der Geburt führt zu Atemproblemen in der postnatalen Phase. Papillome treten am häufigsten im Mund-Rachen-Raum des Kindes auf und wachsen dort, was dem Baby die Atmung erschweren kann.
Diagnose
Viren sind mikroskopisch kleine Krankheitserreger, die die Zellen eines lebenden Organismus befallen. Es kann jedoch lange dauern, bis zelluläre Veränderungen äußerlich sichtbar werden. Während der langen Inkubationszeit vermutet eine Person möglicherweise nicht einmal eine Infektion, und selbst nach Auftreten der ersten Symptome können Zweifel bestehen bleiben, da einige Manifestationen der Krankheit sehr unspezifisch sind.
HPV Typ 56 ist einer der onkogenen Typen des Papillomavirus, der zwar selten vorkommt, aber unter bestimmten Umständen Krebs verursachen kann (meistens eine Onkologie des Fortpflanzungssystems). Aber selbst ein geringes Risiko bleibt ein Risiko, das nicht ignoriert werden kann. Und je früher der Erreger einer gefährlichen Krankheit erkannt wird, desto mehr Möglichkeiten gibt es, ihn zu vermeiden oder zumindest den pathologischen Prozess zu verlangsamen.
Ein charakteristisches Symptom für das Vorhandensein von HPV-Viruspartikeln im Körper ist das Auftreten eigenartiger Wucherungen auf Haut und Schleimhäuten in Form von Warzen, Papillomen und Kondylomen. Letztere werden auch Genitalwarzen genannt, deren Auftreten höchstwahrscheinlich auf das Eindringen eines gefährlichen Virustyps in die Körperzellen hinweist.
Aber selbst ein Spezialist kann den Virustyp nicht mit dem Auge bestimmen. Bevor Sie also Rückschlüsse auf das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Krebs ziehen, müssen Sie sich einer speziellen Untersuchung in einer medizinischen Einrichtung oder einem zertifizierten Labor unterziehen.
Ein Patient kann Hautausschläge am Körper auch ohne ärztliche Hilfe feststellen. Bei Frauen ist es schwieriger, Hautausschläge an den Genitalien und inneren Geschlechtsorganen zu bemerken. Bei Männern wird das Vorhandensein des Virus in der Regel durch spezifische Hautausschläge am Penis (Feigwarzen, Plaques, ungewöhnliche Neoplasien von leuchtender Farbe) nachgewiesen. Normalerweise konsultieren Männer gerade wegen ihres Aussehens einen Urologen, Andrologen oder Venerologen.
Wichtig ist jedoch nicht nur die Feststellung des Virus, sondern auch dessen Typ. Dazu ist ein HPV-Test erforderlich. Herkömmliche serologische Untersuchungen (Blutuntersuchungen auf Antikörper und Antigene) sind in diesem Fall wirkungslos. Als Testmaterial für das Papillomavirus bei Männern dient in der Regel ein Abstrich oder eine Abschabung aus dem betroffenen Genitalbereich sowie aus dem After, wo modifizierte Partikel nachgewiesen werden können.
Bei Frauen erfolgt eine körperliche Untersuchung und die Entnahme von Material für Laboruntersuchungen (ein Vaginalabstrich für die Zytologie oder ein Pap-Test, der im Rahmen einer Untersuchung auf dem gynäkologischen Stuhl oder einer Kolposkopie durchgeführt wird) durch einen Gynäkologen.
Die Analyse auf HPV Typ 56 erfolgt analog zur Analyse anderer Papillomavirustypen. Zytologische und histologische Untersuchungen helfen, das Vorhandensein und die Prävalenz atypischer Zellen, die unter dem Einfluss des Virus ihre Form und Eigenschaften verändert haben, zu beurteilen und maligne Zellen zu identifizieren. Der Virustyp kann jedoch nur durch spezielle Untersuchungen bestimmt werden. Diese Methoden sind: Southern Blot, Dot Blot, Reverse Blot, markierte Sonden, nicht-radioaktives Hybrid Capture (Daigen-Test), PCR-Analyse.
In diesem Fall liefert die PCR-Analyse das genaueste Ergebnis (ca. 95 %) bei einer minimalen Anzahl pathologisch veränderter Zellen, während bei ausreichender Prävalenz des Verfahrens der Daigen-Test am zugänglichsten, am einfachsten durchzuführen und daher recht weit verbreitet ist. Beide Studien ermöglichen nicht nur die Identifizierung der Onkogenität des Virus, sondern auch die Berechnung der Viruskonzentration im Gewebe der Genitalien.
Der Daigen-Test und die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) sind die gängigsten Methoden zur Bestimmung onkogener Typen des Papillomavirus. Sie sind völlig schmerzlos und nicht traumatisch und erfordern keine arbeitsintensive Vorbereitung.
Voraussetzungen zur Vorbereitung der Analyse:
- 3 Tage vor der Entnahme von Biomaterial dürfen keine Antibiotika und antiviralen Medikamente eingenommen werden.
- Während dieser Zeit sollten Sie auf die Verwendung solcher Produkte für die Intimhygiene verzichten (wir sprechen von Verhütungsgelen, Salben usw.), und es ist besser, ganz auf Geschlechtsverkehr zu verzichten.
- Am Vorabend der Analyse werden keine gründlichen Hygienemaßnahmen im Intimbereich durchgeführt, um eine Verfälschung der Ergebnisse zu vermeiden.
Kontraindikationen für die Analyse bei Frauen sind die Periode der Menstruation und 2-3 Tage danach.
Die Entschlüsselung der Analyse auf HPV 56 oder einen anderen Papillomavirustyp ist die Aufgabe von Spezialisten. Jeder Patient hat jedoch nach Erhalt der Testergebnisse das Recht und möchte zumindest die grundlegenden Kriterien zur Beurteilung des Vorhandenseins und der Konzentration des untersuchten Virustyps im Körper kennen.
Wenn Neoplasien im Genitalbereich, insbesondere am Gebärmutterhals, festgestellt werden, verschreiben Ärzte sofort einen Test zum Nachweis onkogener Virustypen. Gleichzeitig gibt es für jeden Virustyp ein separates Reagenz, mit dem sich die DNA des Virus nachweisen und seine Konzentration berechnen lässt. Ein positives Testergebnis zeigt an, dass ein bestimmter Virustyp im Körper nachgewiesen wurde, beispielsweise HPV Typ 56, und ein negatives Testergebnis bedeutet, dass die Person nicht infiziert ist, was jedoch das Vorhandensein anderer Papillomavirustypen nicht ausschließt.
Ein positives PCR-Testergebnis kann folgende Varianten aufweisen:
- + - schwach positiv, was auf eine geringe Menge nachgewiesener viraler DNA hinweist (entweder handelt es sich um eine „frische“ Infektion, oder das Immunsystem hält die Ausbreitung des Virus zurück, oder es handelt sich um die allmähliche Eliminierung des Virus aus dem Körper bei guter Immunität oder der Wirksamkeit einer antiviralen Behandlung),
- ++ - mäßig positiv bei einer höheren Konzentration von Viruspartikeln, wenn Virionen die Fähigkeit haben, sich vor dem Hintergrund einer geschwächten Immunität zu vermehren,
- +++ – eindeutig positiv, was auf eine hohe Virusaktivität und ein erhebliches Risiko für Zellmalignität hinweist.
Die Ergebnisse des Daigen-Tests können wie folgt interpretiert werden:
- Lg im Bereich von 1 bis 3 zeigt eine niedrige Konzentration von Viruspartikeln an,
- Lg von 3 bis 5 zeigt eine klinisch signifikante Konzentration des Virus an,
- Lg über 6 weist auf eine hohe Virionenkonzentration und deren erhöhte Aktivität hin.
Enthält das Testformular den Vermerk „DNA nicht nachgewiesen“, bedeutet dies, dass das humane Papillomavirus nicht vorhanden ist oder die Virionenkonzentration zu gering ist, um es mit dieser Untersuchungsmethode nachzuweisen.
Ziehen Sie jedoch keine voreiligen Schlüsse, nachdem Sie die Testergebnisse eine Woche später erhalten haben. Nur ein Facharzt kann eine endgültige Diagnose stellen. Darüber hinaus gibt es einen bestimmten Prozentsatz an Ergebnissen, die als falsch positiv und falsch negativ bezeichnet werden. Dies ist auf eine unsachgemäße Vorbereitung der Analyse, unsachgemäße Lagerung des Biomaterials, dessen Kontamination und die Inkompetenz des Spezialisten zurückzuführen, der die hochempfindliche Analyse durchgeführt hat. In diesem Fall müssen Sie sich nach einigen Monaten einer erneuten Untersuchung mit der einen oder anderen HPV-Diagnosemethode unterziehen.
Behandlung
Die endgültige Diagnose und die Verschreibung der entsprechenden Behandlung liegen ausschließlich in der Kompetenz des Facharztes. Doch nachdem man die Testergebnisse erhalten hat, gerät man in Panik, wenn man auf dem Formular unverständliche Zeichen, Zahlen und Wörter sieht.
Wenn es um die menschliche Gesundheit geht, weicht die Vernunft meist der Panik, und das ist die Wahrheit. Doch der HPV-Typ 56 bedeutet nicht, dass der Patient Krebs hat. Es gibt andere Virustypen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit Krebs verursachen, und selbst bei ihnen ist die Fallzahl gering.
Was also tun, wenn die Tests HPV Typ 56 ergeben? Keine Panik, sondern einen Arzt aufsuchen und seinen Anweisungen folgen. Man sollte sich nicht als Arzt bezeichnen, ohne über die entsprechende medizinische Ausbildung zu verfügen und sich selbst verschiedene Medikamente und Verfahren verschreiben zu lassen, und vor allem selbst ausprobieren, was die Großtante der Nachbarin aus dem ersten Stock empfohlen hat.
Die meisten Leser wissen, dass Viren eine unangenehme Eigenschaft haben: Sie lassen sich nicht aus dem Körper entfernen oder mit Medikamenten zerstören, wie Bakterien mit Antibiotika. Nur der Körper selbst kann mit solch heimtückischen Krankheitserregern mithilfe eines starken Immunsystems fertig werden. Daher besteht die Behandlung des Papillomavirus in erster Linie darin, die Immunität aufrechtzuerhalten und zu stärken, das Virus zu deaktivieren und die negativen Folgen der Anwesenheit des Erregers im Körper (Papillome, Kondylome, Dysplasie, Krebstumoren) zu beseitigen.
Die Folgen einer HPV-Infektion Typ 56 werden in der Regel chirurgisch behandelt. Je nach ärztlicher Beratung und Patientenwunsch sowie Art und Prävalenz der äußeren Symptome stehen verschiedene Behandlungsmethoden zur Verfügung: chirurgische Entfernung von Neoplasien, Laserbehandlung, Kryotherapie, Chemodestruktion, Radiowellentherapie und Elektrokoagulation. Werden maligne Zellen nachgewiesen, wird bevorzugt Gewebe mit atypischen Zellen chirurgisch entfernt und anschließend die Biopsie histologisch untersucht. In schweren Fällen wird die Gebärmutter entfernt, um das Leben der Patientin zu retten.
Es ist wichtig zu verstehen, dass ein langfristiger Rückfall, geschweige denn eine vollständige Heilung, nicht durch die bloße Entfernung von Neoplasien erreicht werden kann. Tatsächlich ist es für einen Arzt schwierig, die Wirksamkeit des Eingriffs zu kontrollieren, ohne feststellen zu können, ob alle infizierten Zellen während des Eingriffs entfernt wurden. Ein Rückfall der Erkrankung wird in etwa der Hälfte der Fälle beobachtet. Manchmal ist es in Ermangelung einer positiven Dynamik notwendig, nacheinander auf verschiedene HPV-Behandlungsmethoden zurückzugreifen, idealerweise sollten jedoch alle mit einer medikamentösen antiviralen und immunstimulierenden Therapie kombiniert werden.
Eine komplexe Behandlung führt zu einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit langfristiger Rückfälle, wenn das Virus inaktiv im Körper vorhanden ist, sich nicht vermehrt und somit keine Gefahr darstellt. Gleichzeitig müssen Sie Ihre Immunität ein Leben lang optimal aufrechterhalten, da das Virus nach einer Schwäche reaktiviert wird, was sich äußerlich durch neue Hautausschläge und dysplastische Prozesse bemerkbar macht.
Antivirale Medikamente gegen HPV haben eine komplexe Wirkung: Sie wirken sich nachteilig auf das Virus aus, verhindern dessen Ausbreitung und stimulieren das Immunsystem. Solche Medikamente sind in Form von Injektionen, Tabletten, Salben, Zäpfchen usw. erhältlich und werden sowohl lokal als auch systemisch angewendet. Die beliebtesten Medikamente gegen das humane Papillomavirus sind Isoprinosin, Cycloferon, Allokin-Alpha, Panavir und einige andere.
Antivirale Medikamente können in Apotheken sowohl ohne spezielles Rezept (rezeptfrei) als auch auf Rezept abgegeben werden. In jedem Fall lohnt es sich, vor dem Kauf eines Medikaments in einer Apotheke einen Arzt zu den im Einzelfall empfohlenen Medikamenten zu konsultieren.
Immunstimulanzien schaden heutzutage fast niemandem von uns, insbesondere nicht denen, deren äußere Erscheinungen auf das Vorhandensein eines Virus hinweisen, was wiederum auf ein schwaches Immunsystem hindeutet. Dies können pflanzliche Präparate (Extrakt aus Echinacea, Rhodiola rosea, Eleutherococcus, Ginseng usw.) sowie spezielle Medikamente (Likopid, Immunomax, Immunofan, Longidaza usw.) sein. Aber auch in diesem Fall ist eine ärztliche Beratung nicht überflüssig.
Bei der Entfernung von Neoplasmen mit volkstümlichen Methoden und speziellen Präparaten ist hier große Vorsicht geboten. Erstens kann die falsche Anwendung von Methoden und Mitteln zu Verletzungen gesunden Gewebes führen. Zweitens wird es sicherlich nicht möglich sein, das Virus auf diese Weise zu beseitigen oder zu deaktivieren, da durch die Entfernung nur äußerer lokaler Anzeichen keine schädliche Wirkung auf das Virus erzielt werden kann, dessen Virionen in anderen Geweben verbleiben können, die sich nicht von gesunden unterscheiden.
Nur eine umfassende Behandlung und die Aufrechterhaltung einer optimalen Immunität können dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und das Risiko einer Krebserkrankung durch HPV 56 oder einen anderen onkogenen Typ auf ein Minimum zu reduzieren.
Prävention HPV-Typ 56
Ist es möglich, das Infektionsrisiko für diejenigen zu verringern, die noch keinen gefährlichen und heimtückischen „Nachbarn“ in ihrem Körper haben? Dies ist möglich, wenn Sie bei der Auswahl Ihrer Sexualpartner wählerisch sind und idealerweise bei einem gesunden bleiben. Wenn bei Ihrem Angehörigen das Virus diagnostiziert wird, lohnt es sich, beim Geschlechtsverkehr Schutz (Kondome) zu verwenden und die persönliche Hygiene, insbesondere nach dem Geschlechtsverkehr, strikt einzuhalten.
Die Hygienevorschriften sind für Alleinstehende nicht überflüssig, und werdenden Müttern kann bereits bei der Schwangerschaftsplanung eine Behandlung des Virus empfohlen werden. Tritt die Infektion während der Schwangerschaft auf, ist es unbedingt erforderlich, den behandelnden Arzt darüber zu informieren. Dies schützt die Frau zwar nicht vor dem Virus, kann aber das in ihrem Mutterleib heranwachsende Baby vor diesem Schicksal bewahren.
Wer das Virus im Körper hat oder dessen äußere Erscheinungen aufweist, sollte sich um seine Angehörigen kümmern. Man sollte das Problem nicht verheimlichen, denn Unwissenheit entbindet nicht von der Verantwortung, und ein geliebter Mensch kann sich mit dem Virus infizieren, ohne es zu ahnen. Spezielle Verhütungsmittel wie Kondome und zertifizierte antivirale Gleitmittel helfen, dies zu verhindern.
Eine weitere wirksame Methode zur Vorbeugung von Virusinfektionen ist die Impfung, obwohl es in unserem Land derzeit nur einen Impfstoff gegen hoch onkogene Virustypen (Typ 16 und 18, die am häufigsten Gebärmutterhalskrebs verursachen) gibt. Aber vielleicht wird es in Zukunft möglich sein, auf diese Weise vor HPV Typ 56 zu schützen, einem Virus mit mäßiger Onkogenität.
Prognose
Das Papillomavirus Typ 56 ist ein onkologisches Krankheitsvirus mit mittlerem Risiko. Es verursacht daher selten Krebs und normalerweise nur bei gleichzeitigem Vorhandensein prädisponierender Faktoren oder mehrerer Virustypen, einschließlich hoch onkogener. Die Prognose der Erkrankung ist in den meisten Fällen günstig, da bei fast 90 % der Patienten das Immunsystem das Virus innerhalb eines Jahres selbstständig deaktiviert.
Unter den übrigen Patienten ist der Anteil derjenigen, die aufgrund von HPV an Krebs erkrankten, äußerst gering. Gleichzeitig gibt es unter ihnen nur wenige Patienten mit dem Virustyp 56. Dies ist jedoch kein Grund, eine so gefährliche Krankheit nachlässig zu behandeln, zumal eine rechtzeitige Behandlung dazu beiträgt, das Krebsrisiko auf nahezu Null zu reduzieren.
Dabei ist seit langem bekannt, dass die meisten Krankheiten leichter zu verhindern sind als die Krankheit selbst und ihre Folgen zu behandeln. Diese Volksweisheit trifft am besten auf das Problem des Papillomavirus zu. Und es ist aufgrund der hohen Prävalenz von HPV zu einem Problem geworden.

