Facharzt des Artikels
Neue Veröffentlichungen
Kleinhirn
Zuletzt überprüft: 07.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
Das Kleinhirn (Cerebellum; Kleinhirn) liegt hinter der Brücke und dem oberen Teil der Medulla oblongata. Es liegt in der hinteren Schädelgrube. Die Okzipitallappen der Großhirnhemisphären hängen über dem Kleinhirn und sind durch die Fissura transversa cerebralis (Großhirnquerfurche) vom Kleinhirn getrennt.
Das Kleinhirn hat eine Ober- und eine Unterseite, deren Grenze der hintere Rand des Kleinhirns bildet, wo eine tiefe horizontale Fissur (Fissura horizontalis) verläuft. Sie beginnt an der Stelle, an der die Mittelstiele in das Kleinhirn eintreten. Die Ober- und Unterseite des Kleinhirns sind konvex. Auf der Unterseite befindet sich eine breite Vertiefung – das Kleinhirntal (Vallecula cerebelli). Die dorsale Oberfläche der Medulla oblongata grenzt an diese Vertiefung. Das Kleinhirn hat zwei Hemisphären (Hiispheria cerebelli) und einen ungepaarten Mittelteil – den Kleinhirnwurm (Vermis cerebelli, ein phylogenetisch älterer Teil). Die Ober- und Unterseite der Hemisphären und des Vermis werden von zahlreichen quer verlaufenden, parallelen Kleinhirnspalten (Fissura cerebelli) durchzogen, zwischen denen sich lange und schmale Gyri (Folia cerebelli) befinden. Gyri-Gruppen, getrennt durch tiefere Furchen, bilden Kleinhirnläppchen (Lobuli cerebelli). Die Kleinhirnfurchen verlaufen ununterbrochen durch die Hemisphären und den Vermis. Jedem Läppchen des Vermis entsprechen zwei (rechten und linken) Läppchen der Hemisphären. Ein isolierterer und phylogenetisch älterer Läppchen jeder Hemisphäre ist der Flocculus. Er grenzt an die ventrale Oberfläche des mittleren Kleinhirnstiels. Mithilfe des langen Stiels des Flocculus (Pedunculus flocculi) ist der Flocculus mit dem Kleinhirnwurm und dessen Nodulus verbunden. Das Kleinhirn ist durch drei Stielpaare mit den angrenzenden Teilen des Gehirns verbunden. Die unteren Kleinhirnstiele (Pedunculi cerebellares cauddles, S. inferiores; seilförmige Körper) verlaufen nach unten und verbinden das Kleinhirn mit der Medulla oblongata. Die mittleren Kleinhirnstiele (Pedilnculi cerebellares medii) sind die dicksten, sie verlaufen nach vorne und gehen in die Brücke über. Die oberen Kleinhirnstiele (Peduncuii cerebellares rostrales, S. siiperiores) verbinden das Kleinhirn mit dem Mittelhirn. Die Kleinhirnstiele enthalten Fasern der Leitungsbahnen, die das Kleinhirn mit anderen Teilen des Gehirns und dem Rückenmark verbinden.
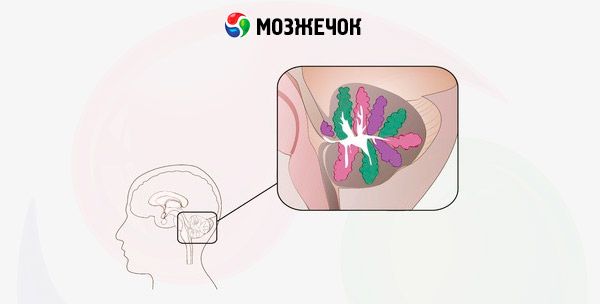
Die Kleinhirnhemisphären und der Wurm bestehen aus dem innen liegenden Gehirnkörper (Corpus medullare), der weißen Substanz und einer dünnen Platte aus grauer Substanz, die die weiße Substanz in der Peripherie bedeckt – der Kleinhirnrinde (Cortex cerebelli).
Die Kleinhirnrinde besteht aus drei Zellschichten. Die oberflächlichste Schicht ist die Molekularschicht, darunter befindet sich eine Schicht birnenförmiger Neuronen (Ganglienschicht) und noch tiefer liegt die Körnerschicht.
Die Molekularschicht wird hauptsächlich von Korb- und Sternneuronen gebildet. Korbneuronen befinden sich im unteren Teil der Molekularschicht. Diese Zellen sind 10 bis 20 µm groß, haben eine unregelmäßige Form und lange Fortsätze. Die Dendriten der Korbneuronen verzweigen sich hauptsächlich über die Windungen des Kleinhirns. Die Axone der Korbneuronen verlaufen auch über die Windungen oberhalb der piriformen Neuronen. Kollaterale verlaufen von den Axonen nach unten zu den Körpern der piriformen Neuronen und verflechten diese, wodurch korbartige Gebilde entstehen. Korbneuronen hemmen mit ihren Impulsen die Funktionen der piriformen Zellen. Sternzellen haben Dendriten unterschiedlicher Länge und ein Axon, das auf den Dendriten der piriformen Zellen Synapsen bildet.
Die Körnerschicht wird von zahlreichen kleinen Neuronen – Körnerzellen – gebildet. Die Fortsätze der Körnerzellen bilden zahlreiche Synapsen (synaptische Knäuel) an anderen Zellen dieser Schicht sowie die Enden von Fasern („Moosfasern“), die im Kleinhirn enden und erregende Impulse übertragen.
Die Schicht der piriformen Neuronen besteht aus großen, einreihig angeordneten Zellen (Purkinje-Zellen). Die Axone der piriformen Zellen entspringen der Kleinhirnrinde und enden an den Zellen ihrer Kerne.
Im Kleinhirn ankommende afferente Nervenimpulse wirken erregend auf die piriformen Neuronen. Diese Impulse werden über die Fasern der spinozerebellären und vestibulozerebellären Bahnen weitergeleitet. Die Nervenfasern durchqueren die Körnerschicht zu den piriformen Zellen, breiten sich entlang ihrer Dendriten („Kletterfasern“) aus und enden in Synapsen an den Körpern der piriformen Neuronen. Afferente Impulse, die von den vestibulären (statovestibulären) Rezeptoren des Innenohrs und von den Propriozeptoren der Skelettmuskulatur im Kleinhirn ankommen, werden analysiert und mit Impulsen aus der Großhirnrinde verglichen. In der Dicke der Kleinhirnschichten erscheint die weiße Substanz als dünne weiße Streifen (Laminae albae).
Die weiße Substanz des Kleinhirns enthält paarige Kleinhirnkerne (Nuclei cerebelli). Der bedeutendste davon ist der Nucleus dentatus (Nucleus dentatus). Auf einem horizontalen Abschnitt des Kleinhirns hat dieser Kern die Form eines dünnen, gekrümmten grauen Streifens, dessen konvexer Teil seitlich und nach hinten zeigt. In medialer Richtung ist der graue Streifen nicht geschlossen; diese Stelle wird als Tor des Nucleus dentatus (Hilum nuclei dentati) bezeichnet. Innerhalb des Nucleus dentatus, in der weißen Substanz der Kleinhirnhemisphäre, befinden sich der korkförmige Kern (Nucleus iboliformis) und der kugelförmige Kern (Nucleus globosus). Hier, in der weißen Substanz des Wurms, befindet sich der medialste Kern - der Zeltkern (Nucleus fastigii).
Die weiße Substanz des Wurms, die von der Rinde begrenzt und entlang der Peripherie durch zahlreiche tiefe und flache Rillen unterteilt ist, weist im Sagittalschnitt ein bizarres Muster auf, das an einen Ast erinnert, daher auch sein Name „Baum des Lebens“ (Arbor vitae cerebelli).
Was bedrückt dich?
Was muss untersucht werden?
Wie zu prüfen?


 [
[