Facharzt des Artikels
Neue Veröffentlichungen
HPV Typ 18 bei Frauen
Zuletzt überprüft: 07.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
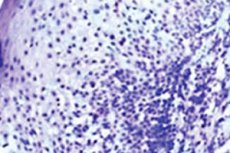
Die Besonderheit des weiblichen Fortpflanzungssystems besteht darin, dass sich seine Organe größtenteils im Körperinneren befinden und selbst vor den Augen der Frau verborgen sind. Wenn pathologische Prozesse in den Eierstöcken, der Vagina, der Gebärmutter oder den Eileitern beginnen, müssen sie sich nicht unbedingt sofort bemerkbar machen. Das Eindringen einer bakteriellen oder viralen Infektion und entzündliche Prozesse in die inneren Geschlechtsorgane kann mit Schmerzen und ungewöhnlichem Ausfluss beginnen oder im Verborgenen verlaufen. Eine zusätzliche Papillomavirus-Infektion erschwert den Krankheitsverlauf jedoch in den meisten Fällen ebenso wie das Vorhandensein von Chlamydien, Mykoplasmen und anderen Krankheitserregern, die den Entzündungsprozess unterstützen.
Es sollte erwähnt werden, dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit dem Papillomavirus bei Menschen im gebärfähigen Alter beiderlei Geschlechts gleich ist. Die Folgen einer solchen Infektion sind jedoch bei Frauen und Männern unterschiedlich. Die Tatsache, dass sich die weiblichen Geschlechtsorgane im Körperinneren befinden und ihre Oberfläche mit einer empfindlichen Schleimhaut bedeckt ist, deren Durchdringung für Virionen nicht schwierig ist, führt dazu, dass das Virus dem schwächeren Geschlecht mehr Schaden zufügt. Außerdem sind Hygienemaßnahmen an inneren Organen schwierig, und die natürliche Reinigung von Gebärmutter und Vagina kann das in die Zellen eindringende Virus nicht vollständig entfernen.
Bei viralen Erkrankungen der Frau treten häufig bakterielle Infektionen auf, die den Körper zusätzlich schwächen, denn für sie ist die warme und feuchte Umgebung der Vagina ein wahres Idyll zum Leben und zur Fortpflanzung, wenn das Immunsystem dies nur zulässt.
Beispielsweise kann eine Zervixerosion, eine der am häufigsten festgestellten Erkrankungen bei einer gynäkologischen Untersuchung, keine spezifischen Symptome hervorrufen. In 90 % der Fälle erfährt eine Frau erst nach einer weiteren gynäkologischen Untersuchung auf dem Stuhl von ihrer Diagnose, da der Arzt nur so den Zustand des weiblichen Fortpflanzungssystems beurteilen kann. Bei manchen Frauen nimmt mit dem Auftreten eines erosiv-entzündlichen Herdes der natürliche physiologische Ausfluss zu. Fehlt jedoch ein unangenehmer Geruch und eine verdächtige gelblich-grünliche Farbe, die auf Eiter hindeutet, ist die Frau möglicherweise nicht besonders besorgt und führt alles auf Unterkühlung und verminderte Immunität zurück.
Viel seltener können Beschwerden beim Geschlechtsverkehr, ein Schweregefühl im Unterbauch und das Auftreten von blutigen Streifen im physiologischen Vaginalausfluss außerhalb der Menstruation auf eine Schädigung der Gebärmutterschleimhaut am Eingang zum Gebärmutterhalskanal hinweisen. Wenn Schmerzen im Unterbauch auftreten, der Menstruationszyklus gestört ist und übelriechender Weißfluss auftritt, handelt es sich weniger um die Erosion selbst als vielmehr um einen Entzündungsprozess, der durch die Aktivierung opportunistischer Mikroorganismen in der Läsion hervorgerufen wird. Es ist jedoch möglich, dass Krankheitserreger (dieselben Chlamydien oder Viren) in die Gebärmutter eingedrungen sind.
Bei Frauen mit chronischer Erosion zeigt die Analyse in den meisten Fällen das Vorhandensein von HPV-Virionen. Dabei muss es sich nicht unbedingt um hochonkogene Virustypen handeln. In der Regel wird eine gemischte Mikroflora nachgewiesen: opportunistische Mikroorganismen, Mykoplasmen, Ureaplasmen, Chlamydien, Papillomaviren (meist ein bis vier Varianten), Herpesviren. Es ist nicht einfach, den Beitrag jedes einzelnen Erregers zur Aufrechterhaltung und Entwicklung des Entzündungsprozesses im betroffenen Bereich zu bestimmen, aber es muss gesagt werden, dass ihre Anwesenheit die Situation immer komplizierter macht und zu einer Vergrößerung der Erosion beiträgt.
Ein langfristiger Erosionsprozess kann irgendwann seinen Charakter verändern und neben einer Entzündung im betroffenen Bereich kann der Arzt ein Wachstum des Schleimhautgewebes (Zervixdysplasie) feststellen. Als einer der Hauptfaktoren, die diesen Prozess auslösen, gilt die Papillomavirus-Infektion. Erosive Herde sind die anfälligsten Stellen der Gebärmutter- und Vaginalschleimhaut, sodass das Virus viel leichter in das Organgewebe und anschließend in die Zellen eindringen kann.
Werden in Abstrichen neben dysplastischen Prozessen, die einen gutartigen Tumor darstellen, auch hochonkogene Papillomavirustypen ( HPV 18 und 16) nachgewiesen, ist mit der Entartung einzelner Tumorzellen zu bösartigen Zellen zu rechnen. Denn die Veränderung der Eigenschaften der Wirtszelle ist im Genom hochonkogener Virionen verankert, und das Verhalten solcher mutierten Zellen unterliegt nicht mehr der Kontrolle des Immunsystems.
Es ist schwer zu sagen, ob das Papillomavirus selbst eine Zervixerosion verursachen kann (falls dies geschieht, wird es nicht so bald passieren). Es kann jedoch durchaus dysplastische Prozesse hervorrufen, auch wenn kein Erosionsprozess vorliegt, indem es in Mikroschäden der Gebärmutter- und Vaginalschleimhaut eindringt, die nach Abtreibungen, aktivem Geschlechtsverkehr und als Folge häufigen und promiskuitiven Geschlechtsverkehrs auftreten können. In diesem Fall verläuft die Dysplasie sehr lange symptomlos. Symptome werden nur durch Begleiterkrankungen (erosive und entzündliche Prozesse, die sich häufig vor dem Hintergrund einer Papillomavirusinfektion entwickeln) verursacht.
Wenn die Ursache der Dysplasie Viren der Typen 16 und 18 sind, entwickelt sich die Krankheit in der Hälfte der Fälle nach 10 oder mehr Jahren zu Gebärmutterhalskrebs. Ärzte rechnen im Voraus mit einem solchen Ergebnis und verschreiben daher immer eine spezielle Analyse, die es ermöglicht, das Virus in einem Abstrich zu identifizieren (die reguläre Abstrichzytologie ist in dieser Hinsicht nicht aussagekräftig) und seinen Typ zu bestimmen. Erosions- und Dysplasieherde müssen entfernt werden, unabhängig davon, ob in ihnen ein hoch onkogener Typ des Papillomavirus nachgewiesen wird. Wird es jedoch entdeckt, ist nicht nur ein chirurgischer Eingriff zur Entfernung pathologischen Gewebes obligatorisch, sondern auch eine regelmäßige anschließende Überwachung des Zustands der Gebärmutterschleimhaut.
Eine weitere Pathologie, deren Entwicklung mit dem papillomatösen Virus in Verbindung gebracht wird, ist eine Ovarialzyste. Eine Zyste gilt als gutartige Neubildung. Sie ähnelt einem Flüssigkeitssack, der sogar größer sein kann als das Organ selbst, es zusammendrückt und die Freisetzung der Eizelle verhindert.
Ärzte assoziieren die Bildung von Zysten mit Operationen an den Genitalien, erosiven und entzündlichen Erkrankungen der Gebärmutter, hormonellen Störungen (in der Hälfte der Fälle), vorzeitiger Menstruation, Zyklusstörungen usw. Idealerweise sollte sich das Neoplasma (Gelbkörperzyste, die aus dem Gelbkörper entsteht, und Follikelzyste, die bei fehlendem Eiaustritt entsteht) von selbst zurückbilden. Hämorrhagische und endometriotische Zysten sind therapeutisch behandelbar.
Die größte Gefahr geht von einer muzinösen Zyste aus, die bei Frauen über 50 auftritt und aus mehreren schnell wachsenden Kammern besteht, sowie von einer paraovariellen Zyste, die sich nicht am Eierstock, sondern an den Eierstöcken bildet und ebenfalls zu schnellem Wachstum neigt. Es ist schwer zu sagen, ob das Papillomavirus etwas mit der Bildung solcher Zysten zu tun hat, aber wenn HPV 16, 18 oder Virionen eines anderen hoch onkogenen Typs im Körper vorhanden sind, besteht ein hohes Risiko, dass sich eine gutartige Neubildung zu einer bösartigen entwickelt.
Wenn bei einer Frau Gebärmutterhalserosion, Eierstockzysten, dysplastische Prozesse in der Gebärmutter und HPV-Typ 16 oder 18 diagnostiziert werden, schlagen Ärzte Alarm. Man kann nicht sagen, dass ein hochgradig onkogenes Virus zwangsläufig Gebärmutterhals- oder Eierstockkrebs auslöst, aber seine Anwesenheit im Körper erhöht das Risiko, an einer tödlichen Krankheit zu erkranken, um ein Vielfaches.
 [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]
[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ]

