Facharzt des Artikels
Neue Veröffentlichungen
Blutungen: Symptome, Stillen von Blutungen
Zuletzt überprüft: 07.07.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
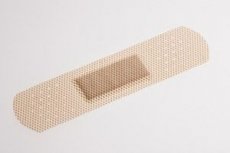
Blutung ist das Austreten von Blut aus einem Gefäß in die äußere Umgebung, in Gewebe oder in eine Körperhöhle. Das Vorhandensein von Blut in einer bestimmten Körperhöhle hat einen eigenen Namen. So wird die Ansammlung von Blut im Brustkorb als Hämatothorax, im Bauchraum als Hämoperitoneum, im Perikard als Hämoperikard, in einem Gelenk als Hämarthrose usw. bezeichnet. Die häufigste Ursache für Blutungen ist ein Trauma.
Eine Blutung ist eine diffuse Sättigung eines beliebigen Gewebes mit Blut (z. B. Unterhautgewebe, Hirngewebe).
Ein Hämatom ist eine im Gewebe eingeschlossene Blutansammlung.
Symptome Hämorrhagien
Die Blutungssymptome hängen vom geschädigten Organ, dem Durchmesser des verletzten Gefäßes und der Blutflussstelle ab. Alle Blutungssymptome werden in allgemeine und lokale Symptome unterteilt.
Die allgemeinen Symptome äußerer und innerer Blutungen sind dieselben. Sie sind Schwäche, Schwindel mit häufigen Ohnmachtsanfällen, Durst, blasse Haut und (insbesondere) Schleimhäute (weiße Lippen), häufiger niedriger Puls, zunehmend fallender und instabiler Blutdruck, ein starker Rückgang der Anzahl roter Blutkörperchen und des Hämoglobingehalts.
Lokale Symptome äußerer Blutungen wurden bereits aufgeführt; die wichtigsten sind Blutungen aus einer Wunde. Lokale Symptome innerer Blutungen sind äußerst vielfältig und ihr Auftreten hängt von der Körperhöhle ab, in die das Blut fließt.
- Bei Blutungen in die Schädelhöhle besteht das Hauptsymptom einer Hirnkompression.
- Bei Blutungen in die Pleurahöhle treten Anzeichen eines Hämatothorax mit einer ganzen Reihe von körperlichen Symptomen (Kurzatmigkeit, Verkürzung des Schlaggeräusches, Abschwächung der Atmung und des Stimmfremitus, Einschränkung der Atemexkursionen) und Daten aus zusätzlichen Forschungsmethoden (Röntgenaufnahme des Brustkorbs, Punktion der Pleurahöhle) auf.
- Bei Blutansammlungen in der Bauchhöhle treten Symptome einer Bauchfellentzündung (Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Muskelverspannungen der vorderen Bauchdecke, Symptome einer Peritonealreizung) und ein Gefühl der Mattheit in den schrägen Bauchpartien auf. Das Vorhandensein von freier Flüssigkeit in der Bauchhöhle wird durch Ultraschall, Punktion oder Laparozentese bestätigt.
- Aufgrund des geringen Volumens der Höhle kommt es nicht zu massiven Blutungen in das Gelenk, so dass es im Gegensatz zu anderen intrakavitären Blutungen nie zu einer akuten, lebensbedrohlichen Anämie kommt.
- Das klinische Bild eines intrageweblichen Hämatoms hängt von seiner Größe, seiner Lokalisation, dem Durchmesser des geschädigten Gefäßes und der vorhandenen Verbindung zwischen diesem und dem Hämatom ab. Lokale Manifestationen sind starke Schwellungen, ein erhöhtes Gliedmaßenvolumen, platzende Gewebeverdichtung und Schmerzen.
Ein fortschreitend wachsendes Hämatom kann zu einer Gangrän der Extremität führen. Geschieht dies nicht, nimmt das Volumen der Extremität etwas ab, es ist jedoch eine deutliche Verschlechterung des Trophismus des distalen Teils der Extremität zu beobachten. Bei der Untersuchung wird oberhalb des Hämatoms eine Pulsation festgestellt, und dort ist auch ein systolisches Geräusch zu hören, das auf die Bildung eines falschen Aneurysmas hinweist.
Was bedrückt dich?
Formen
Es gibt keine einheitliche internationale Klassifikation von Blutungen. Es wurde eine „Arbeits“-Klassifikation verabschiedet, die die wichtigsten Aspekte dieses komplexen Problems widerspiegelt, die für die praktische Tätigkeit notwendig sind. Die Klassifikation wurde von Akademiemitglied BV Petrovsky für die klinische Praxis vorgeschlagen. Sie umfasst mehrere Hauptpositionen.
- Nach anatomischen und physiologischen Prinzipien werden Blutungen in arterielle, venöse, kapilläre und parenchymatische Blutungen unterteilt; sie weisen Merkmale im Krankheitsbild und in den Stillungsverfahren auf.
- Bei einer arteriellen Blutung ist das Blut scharlachrot, fließt in einem pulsierenden Strahl heraus, stoppt nicht von selbst, was schnell zu einer schweren akuten Anämie führt.
- Bei einer venösen Blutung ist das Blut dunkel gefärbt und fließt umso langsamer ab, je kleiner der Gefäßdurchmesser ist.
- Parenchym- und Kapillarblutungen sind äußerlich gleich, ihr Unterschied zu den vorherigen liegt im Fehlen einer sichtbaren Blutungsquelle sowie in der Dauer und Komplexität der Hämostase.
- Basierend auf klinischen Manifestationen werden Blutungen in äußere und innere (hohle, versteckte) Blutungen unterteilt.
- Bei äußeren Blutungen tritt Blut in die Umgebung aus.
- Bei inneren Blutungen gelangt Blut in eine Körperhöhle oder ein Hohlorgan. Versteckte Blutungen durch Verletzungen kommen fast nie vor. Häufige Ursache sind Magen- und Darmgeschwüre.
- Je nach Zeitpunkt des Auftretens der Blutung unterscheidet man primäre, sekundäre Früh- und sekundäre Spätblutungen.
- Primäre beginnen unmittelbar nach der Verletzung.
- Sekundäre Frühblutungen treten in den ersten Stunden und Tagen nach der Verletzung auf, wenn der Thrombus aus dem verletzten Gefäß herausgedrückt wird. Die Ursachen dieser Blutungen sind eine Verletzung der Immobilisierungsprinzipien, eine frühzeitige Aktivierung des Patienten und erhöhter Blutdruck.
- Nachblutungen können jederzeit nach der Wundvereiterung auftreten. Ursache hierfür ist die eitrige Auflösung eines Thrombus oder einer Gefäßwand durch einen entzündlichen Prozess.
Arterielle Blutung
Tritt bei einer Arterienverletzung auf: scharlachrotes, leuchtend rotes Blut, das wie ein Springbrunnen in einem Strahl aus der Wunde spritzt. Die Intensität des Blutverlustes hängt von der Größe des beschädigten Gefäßes und der Art der Verletzung ab. Starke Blutungen treten bei lateralen und penetrierenden Wunden arterieller Gefäße auf. Bei transversalen Gefäßrupturen kommt es häufig zu einem spontanen Blutstillstand aufgrund der Kontraktion der Gefäßwände, der Inversion der gerissenen Intima in ihr Lumen und der anschließenden Thrombusbildung. Arterielle Blutungen sind lebensbedrohlich, da in kurzer Zeit viel Blut verloren geht.
 [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]
[ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]
Venöse Blutungen
Bei venösen Blutungen ist das austretende, sauerstoffarme Blut dunkel gefärbt, pulsiert nicht, fließt langsam in die Wunde und das periphere Gefäßende blutet stärker. Verletzungen großer, herznaher Venen sind nicht nur wegen starker Blutungen gefährlich, sondern auch wegen einer Luftembolie: Luft, die beim Atmen in das Lumen eines Blutgefäßes eindringt und die Durchblutung des Lungenkreislaufs beeinträchtigt, führt häufig zum Tod des Patienten. Venöse Blutungen aus mittleren und kleinen Gefäßen sind weniger lebensbedrohlich als arterielle Blutungen. Langsamer Blutfluss aus venösen Gefäßen und Gefäßwände, die bei Kompression leicht kollabieren, tragen zur Thrombusbildung bei.
Aufgrund der Besonderheiten des Gefäßsystems (die gleichnamigen Arterien und Venen liegen nahe beieinander) sind isolierte Schäden an Arterien und Venen selten, sodass die meisten Blutungen gemischter (arteriell-venöser) Art sind. Eine solche Blutung tritt auf, wenn Arterie und Vene gleichzeitig verletzt sind und ist durch eine Kombination der oben beschriebenen Symptome gekennzeichnet.
Kapillarblutung
Tritt auf, wenn Schleimhäute und Muskeln beschädigt sind. Bei Kapillarblutungen blutet die gesamte Wundoberfläche, Blut „sickert“ aus beschädigten Kapillaren, die Blutung stoppt, wenn ein einfacher oder leicht drückender Verband angelegt wird.
Verletzungen der Leber, Nieren und Milz gehen mit parenchymatösen Blutungen einher. Die Gefäße der parenchymatösen Organe sind fest mit dem Bindegewebsstroma des Organs verwachsen, was deren Spasmus verhindert; ein spontanes Stillen der Blutung ist schwierig.
 [ 19 ]
[ 19 ]
Äußere Blutungen
Dabei handelt es sich um das Austreten von Blut auf die Körperoberfläche aus Wunden, Geschwüren (normalerweise aus Krampfadern) und selten aus Hauttumoren.
Nach der Art des blutenden Gefäßes werden sie unterteilt in: arterielle (Blut ist scharlachrot, spritzt und pulsiert, wenn ein großes Gefäß verletzt ist); venöse (Blut ist dunkel, fließt träge, kann aber intensiv sein, wenn große Venen verletzt sind); Kapillare (Schwitzen in Form einzelner Tropfen, die miteinander verschmelzen; bei starker Hautschädigung können sie zu massivem Blutverlust führen). Zeitlich gesehen sind die meisten Blutungen primär. Sekundärblutungen treten selten auf, hauptsächlich erosiv durch Geschwüre.
Die Diagnose äußerer Blutungen ist unkompliziert. Taktik: Vor Ort werden Methoden zur vorübergehenden Blutstillung besprochen, anschließend erfolgt der Transport in ein chirurgisches Krankenhaus zur endgültigen Blutstillung und Korrektur des Blutverlustes.
 [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]
[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]
Intratissue-Blutungen
Sie entstehen durch Traumata (Prellungen, Frakturen), Erkrankungen mit erhöhter Gefäßdurchlässigkeit oder Blutgerinnungsstörungen (Hämophilie, Aureka-Syndrom bei Leberversagen und Hypovitaminose K), Gefäßrupturen und Aneurysmadissektionen. Sie können oberflächlich in der Haut, im Unterhautgewebe und in den Intermuskulaturräumen auftreten; und intraorganisch (vorwiegend in parenchymatösen Organen) durch Traumata (Prellungen) und Aneurysmarupturen. Man unterscheidet zwei Typen.
- Bei gleichmäßiger Gewebesättigung mit Erythrozyten (Imbibition) spricht man von einer Blutung. Oberflächliche Blutungen bereiten keine diagnostischen Schwierigkeiten, da sie mit bloßem Auge als Bluterguss sichtbar sind, der sich mit allmählichem Verblassen von selbst auflöst: In den ersten beiden Tagen hat er einen violett-violetten Farbton; bis zum 5.-6. Tag - blau; bis zum 9.-10. Tag - grün; bis zum 14. Tag - gelb.
- Als Hämatom bezeichnet man eine freie Ansammlung von flüssigem Blut – im Unterhautgewebe, in den Intermuskulaturräumen, in lockeren Geweben, beispielsweise im Retroperitonealraum; im Gewebe parenchymatöser Organe.
Oberflächliche Hämatome mit Blutansammlungen im Unterhautgewebe und den Intermuskulaturräumen entstehen durch Traumata (Prellungen, Frakturen etc.) oder, selten, durch Rupturen von Gefäßaneurysmen. Klinisch gehen sie mit einer Volumenzunahme des Segments einher, das oft über die Prellung hinausragt. Die Palpation zeigt eine elastische, weiche, mäßig schmerzhafte Formation, meist mit einem Fluktuationssymptom (Gefühl von Flüssigkeitsfluss unter der Hand). Im Falle einer Aneurysmaruptur wird zusätzlich ein Pulsieren des Hämatoms festgestellt, das manchmal mit dem Auge sichtbar ist. Bei der Auskultation ist ein systolisches Geräusch zu hören. Die Diagnose bereitet in der Regel keine Schwierigkeiten, kann aber im Zweifelsfall durch eine Angiographie bestätigt werden.
Hämatome können eitrig werden und ein typisches Bild eines Abszesses ergeben.
Taktik: Prellungen; ambulante Behandlung durch Chirurgen oder Traumatologen; bei Hämatomen ist ein Krankenhausaufenthalt ratsam.
Intrakavitäre Blutung
Unter intrakavitären Blutungen versteht man Blutungen in seröse Hohlräume. Blutungen: in die Schädelhöhle werden als intrakranielles Hämatom definiert; in die Pleurahöhle als Hämatothorax; in die Perikardhöhle als Hämoperikard; in die Bauchhöhle als Hämoperitoneum; in die Gelenkhöhle als Hämarthrose. Blutungen in die Höhle sind nicht nur ein Syndrom, das den Verlauf des zugrunde liegenden pathologischen Prozesses, häufiger ein Trauma, kompliziert, sondern auch die wichtigste offensichtliche Manifestation einer Verletzung oder Ruptur des parenchymatösen Organs.
Intrakranielle Hämatome entstehen hauptsächlich durch ein Schädel-Hirn-Trauma, seltener durch Ruptur von Gefäßaneurysmen (häufiger bei Jungen im Alter von 12-14 Jahren bei körperlicher Anstrengung). Sie gehen mit einem ziemlich ausgeprägten Krankheitsbild einher, erfordern jedoch eine Differentialdiagnose mit schweren Hirnkontusionen und intrazerebralen Hämatomen, obwohl sie oft mit einer Meningitis einhergehen.
Ein Hämatothorax kann sich bei einer geschlossenen Brustverletzung mit Schädigung der Lunge oder der Interkostalarterie, penetrierenden Brustwunden und thorakoabdominellen Verletzungen sowie Rupturen vaskularisierter Lungenbullae bei bullösem Emphysem entwickeln. Auch in diesen Fällen ist ein Hämatothorax eine Manifestation einer Schädigung. In seiner reinen Form (nur Blutansammlung) tritt ein Hämatothorax nur bei isolierter Schädigung der Interkostalgefäße auf. In allen Fällen einer Lungenschädigung ist die Bildung eines Hämopneumothorax ein Zeichen für eine Verletzung der Lungendichtheit, bei dem zusammen mit der Blutansammlung die Lunge kollabiert und sich Luft in der Pleurahöhle ansammelt. Klinisch geht dies mit einem Bild anämischer, hypoxischer, hypovolämischer und pleuraler Syndrome einher. Zur Bestätigung der Diagnose sind eine Röntgenaufnahme der Lunge, eine Punktion der Pleurahöhle und, falls angezeigt und möglich, eine Thorakoskopie erforderlich. Die Differentialdiagnostik erfolgt bei Pleuritis, Chylothorax, Hämopleuritis hauptsächlich anhand von Punktionsdaten und Laboruntersuchungen der Punktion.
Ein Hämoperikard entsteht bei geschlossenen und penetrierenden Brustverletzungen, wenn die Wirkung des Erregers auf die vorderen Brustbereiche fällt. Das Perikard enthält nur 700 ml Blut, Blutverlust führt nicht zur Entwicklung eines akuten Anämiesyndroms, aber ein Hämoperikard ist aufgrund einer Herzbeuteltamponade gefährlich.
Das klinische Bild ist charakteristisch und geht mit einer raschen Entwicklung einer Herzinsuffizienz einher: Bewusstseinsdepression; fortschreitender (buchstäblich minütlicher) Blutdruckabfall; Zunahme der Tachykardie mit deutlicher Abnahme der Füllung, anschließend – mit Übergang zur Filiformität, bis zum vollständigen Verschwinden. Gleichzeitig nehmen allgemeine Zyanose, Akrozyanose, Zyanose der Lippen und der Zunge rasch zu. Differenzialdiagnostisch ist zu beachten, dass eine solche fortschreitende Entwicklung eines Herz-Kreislauf-Versagens bei keiner Herzerkrankung auftritt, auch nicht bei einem Myokardinfarkt – entweder tritt ein sofortiger Herzstillstand auf oder es kommt zu einem langsamen Fortschreiten. Die in Extremsituationen schwierig durchzuführende Perkussion zeigt eine Erweiterung der Grenzen des Herzens und des Herz-Kreislauf-Bündels. Auskultation: Vor dem Hintergrund stark abgeschwächter Herztöne ist in den ersten Minuten ein plätscherndes Geräusch zu hören; anschließend treten extrem gedämpfte Töne und häufiger das Symptom „Flattern“ auf. Es ist notwendig, von einer Perikarditis zu unterscheiden. In allen Fällen muss der Komplex mit einer Perikardpunktion und einem EKG beginnen und nach der Entlastung des Perikards eine Röntgenaufnahme und andere Untersuchungen durchführen.
Hämoperitoneum entwickelt sich bei geschlossenen und penetrierenden Bauchtraumata, Perforationen von Hohlorganen, Ovarialapoplexie und Eileiterschwangerschaft mit Ruptur der Eileiter. Da die Bauchhöhle bis zu 10 Liter Flüssigkeit enthält, geht Hämoperitoneum mit der Entwicklung eines akuten Anämiesyndroms einher.
Bei Schäden an Magen, Leber und Darm, deren Inhalt das Bauchfell stark reizt, entwickelt sich sofort das klinische Bild einer Bauchfellentzündung. Bei einem „reinen“ Hämoperitoneum glättet sich das Bild, da das Blut keine starke Reizung des Bauchfells verursacht. Der Patient leidet unter mäßigen Bauchschmerzen, die im Sitzen nachlassen (Symptom „Tumbler-Toss“), da das Blut vom Solarplexus in das kleine Becken fließt und die Reizung gelindert wird; Schwäche und Schwindel – aufgrund von; Blutverlust; Blähungen – aufgrund mangelnder Peristaltik. Bei der Untersuchung: Der Patient ist blass, oft mit einer aschfahlen Tönung der Gesichtshaut; lethargisch und gleichgültig – aufgrund der Entwicklung eines hämorrhagischen Schocks; bei der Palpation – der Bauch ist weich, mäßig schmerzhaft, Symptome einer Bauchfellreizung treten nicht auf; Perkussion, nur bei großen Mengen Hämoperitoneum - Dumpfheit in den Flanken, in anderen Fällen - Tympanitis aufgrund einer Darmüberblähung.
Hämarthrose ist eine Blutung in die Gelenkhöhle, die hauptsächlich bei Verletzungen auftritt. Am häufigsten sind Kniegelenke betroffen, die der maximalen körperlichen Belastung ausgesetzt sind und eine erhöhte Gefäßversorgung aufweisen. Andere Gelenke verursachen selten Hämarthrose und weisen kein so auffälliges Krankheitsbild auf.
Intraorganische Blutungen sind Blutergüsse in Hohlorgane. Sie sind nach äußeren Blutungen die zweithäufigste. Sie sind nicht nur wegen des Blutverlusts gefährlich, sondern auch wegen der Funktionsstörung innerer Organe. Sie sind schwierig zu diagnostizieren, Erste Hilfe zu leisten und eine Behandlungsmethode für die zugrunde liegende Pathologie zu wählen, die die Blutung verursacht hat.
Lungenblutung
Die Ursachen einer Lungenblutung sind vielfältig: atrophische Bronchitis, Tuberkulose, Abszesse und Gangrän der Lunge, Bronchialpolypen, Missbildungen, Lungentumore, Infarktpneumonie usw. Diese Art der Blutung gilt als die gefährlichste, nicht wegen des Blutverlusts, sondern weil sie zur Entwicklung eines akuten Atemversagens führt, da sie entweder eine Hämoaspiration (Einatmen von Blut in die Alveolen mit deren Blockade) oder eine Atelektase der Lunge verursacht, wenn diese vollständig mit Blut gefüllt ist.
Beim Husten tritt schaumiges, scharlachrotes Blut aus (bei Alveolartumoren und Infarktpneumonie rosa).
Der Patient kann dieses Blut verschlucken, was zu Reflexerbrechen in Form von „Kaffeesatz“ führt. Der Auswurf muss in Messgefäßen gesammelt werden. Anhand der Menge wird die Intensität der Blutung beurteilt, und der Auswurf wird auch zur Laboruntersuchung geschickt. Bei einer Blutung von bis zu 200 ml pro Tag spricht man von Hämoptyse; bei bis zu 500 ml pro Tag von starker Blutung; bei einer größeren Menge von starker Blutung.
Die Diagnose wird nicht nur durch das klinische Bild bestätigt: Hämoptyse, akutes Atemversagensyndrom, Kakophonie während der Auskultation der Lunge. Aber auch radiologisch manifestiert sich die Hämoaspiration durch mehrere kleine Verdunkelungen in der Lunge in Form eines "Geldsturms", Atelektase - homogene Verdunkelung der Lunge - der gesamten oder der Unterlappen, mit einer Verschiebung des Mediastinums: zur Seite der Verdunkelung (bei Verdunkelungen durch Erguss in der Pleurahöhle verschiebt sich das Mediastinum auf die gegenüberliegende Seite); bei Infarktpneumonie - dreieckige Verdunkelung der Lunge mit der Spitze zur Wurzel. Eine Bronchoskopie mit einem Tubusendoskop ist unbedingt angezeigt.
Ein solcher Patient sollte stationär aufgenommen werden: wenn Hinweise auf einen Tuberkulose-Prozess vorliegen – in der chirurgischen Abteilung der Tuberkulose-Ambulanz; wenn keine Tuberkulose vorliegt – in der Abteilung für Thoraxchirurgie; bei Tumoren der Lunge und der Bronchien – in onkologischen Ambulanzen oder der Thoraxabteilung.
Gastrointestinale Blutungen
Sie entwickeln sich bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren, Kolitis, Tumoren, Schleimhautrissen (Mallory-Weiss-Syndrom), atrophischer und erosiver Gastritis (insbesondere nach dem Trinken von Ersatzgetränken).
Zur Diagnose und Bestimmung der Intensität dieser Blutungsart sind 2 Hauptsymptome wichtig: Erbrechen und Stuhlveränderungen. Bei schwacher Blutung: Erbrechen in Form von „Kaffeesatz“, geformter Stuhl, schwarz; Farbe. Bei starker Blutung: Erbrechen in Form von Blutgerinnseln; flüssiger Stuhl, schwarz (Meläna). Bei starker Blutung: Erbrechen von nicht geronnenem Blut; Stuhl oder kein Stuhl oder Schleim in Form von „Himbeergelee“ wird freigesetzt. Auch bei Verdacht ist eine Notfall-FGDS angezeigt. Eine Röntgenaufnahme des Magens wird in der akuten Phase nicht durchgeführt.
Speiseröhrenblutungen treten aus Krampfadern der Speiseröhre bei portaler Hypertonie auf, die durch Leberversagen bei Leberzirrhose, Hepatitis und Lebertumoren verursacht wird. Das klinische Bild der Blutung selbst ähnelt einer gastrointestinalen Blutung. Das Erscheinungsbild des Patienten ist jedoch typisch für ein Leberversagen: Die Haut ist fahl, oft ikterisch, das Gesicht ist geschwollen, auf den Wangenknochen befindet sich ein Kapillarnetz, die Nase ist bläulich, erweiterte und gewundene Venen sind auf Brust und Rumpf sichtbar; Der Bauch kann aufgrund von Aszites vergrößert sein; Die Leber ist oft stark vergrößert, dicht, beim Abtasten schmerzhaft, kann aber auch atrophisch sein. In allen Fällen haben diese Patienten eine Rechtsherzinsuffizienz mit Hypertonie des Lungenkreislaufs: Kurzatmigkeit, Druckinstabilität, Arrhythmie - bis hin zur Entwicklung eines Lungenödems. Zur Diagnose und Differentialdiagnose ist eine Notfall-FGDS angezeigt.
Darmblutungen – aus Rektum und Dickdarm – werden am häufigsten durch Hämorrhoiden und Analfissuren verursacht; seltener durch Polypen und Tumoren des Rektums und Dickdarms; noch seltener durch unspezifische Colitis ulcerosa (NUC). Blutungen aus dem oberen Dickdarm gehen mit flüssigem, blutigem Stuhl in Form von Blutgerinnseln oder Meläna einher. Rektumblutungen sind mit hartem Stuhl verbunden, Blutungen aus Tumoren oder Polypen beginnen vor dem Stuhlgang, Blutungen aus Hämorrhoiden und Analfissuren treten nach dem Stuhlgang auf. Sie sind venös, nicht stark und hören leicht von selbst auf.
Zur Differentialdiagnose werden eine externe Untersuchung des Analrings, eine digitale Untersuchung des Rektums, eine Untersuchung des Rektums mit einem Rektalspiegel, eine Rektoskopie und eine Koloskopie durchgeführt. Der komplexe Einsatz dieser Untersuchungsmethoden ermöglicht eine genaue topische Diagnose. Röntgenmethoden. Die U-Forschung (Irrigoskopie) wird nur bei Verdacht auf Krebs eingesetzt. Bei Blutungen aus Dickdarm und Sigma hat die Koloskopie den größten diagnostischen Effekt, da nicht nur die Schleimhaut sorgfältig untersucht, sondern auch das blutende Gefäß koaguliert werden kann – eine Elektroresektion des blutenden Polypen.
Postoperative Blutungen
In der Regel sind sie frühzeitig sekundär. Blutungen aus postoperativen Wunden treten auf, wenn ein Thrombus aus den Wundgefäßen herausgedrückt wird. Die Maßnahmen beginnen mit dem Auflegen eines Eisbeutels auf die Wunde. Bei anhaltender Blutung werden die Wundränder gespreizt und eine Blutstillung durchgeführt: durch Ligatur des Gefäßes, Vernähen des Gefäßes mit Gewebe, Diathermokoagulation.
Um die Möglichkeit intraabdominaler Blutungen zu kontrollieren, werden nach der Operation röhrenförmige Drainagen in die Bauch- und Pleurahöhlen eingeführt, die an Vakuumaspiratoren verschiedener Art angeschlossen werden: direkt an die Drainagen („Birnen“) oder über Bobrov-Gläser. Normalerweise werden in den ersten zwei Tagen bis zu 100 ml Blut durch die Drainagen freigesetzt. Bei Blutungen beginnt ein starker Blutfluss durch die Drainagen. Dies kann zwei Gründe haben.
Afibrinogene Blutung
Sie entstehen bei hohem Verbrauch von Blutfibrinogen, was bei langen, über zwei Stunden dauernden Operationen an Bauch- und Brustorganen zu massivem Blutverlust mit der Entwicklung eines DIC-Syndroms führt. Kennzeichnend für diese Blutungen ist, dass sie früh nach der Operation einsetzen (fast sofort, obwohl der Chirurg von der Hämostase überzeugt ist); sie verlaufen langsam und sprechen nicht auf eine hämostatische Therapie an. Bestätigt wird dies durch eine Bestimmung des Blutfibrinogengehalts. Durch eine Transfusion von Spenderfibrinogen (dies ist jedoch sehr knapp) kann der Blutfibrinogenspiegel wiederhergestellt und die Blutung folglich gestoppt werden. Dies kann durch Reinfusion des in die Körperhöhlen strömenden Eigenbluts erfolgen. Es wird in einem sterilen Bobrov-Gefäß ohne Konservierungsmittel gesammelt, gefiltert und reinfundiert. Der Blutfibrinogenspiegel stellt sich innerhalb von 2-3 Tagen von selbst wieder her.
Eine deutliche frühe Nachblutung entsteht, wenn die Ligatur aufgrund eines Anwendungsfehlers vom Gefäß abrutscht. Ein besonderes Merkmal ist der plötzliche und massive Blutfluss durch die Drainagen mit einer deutlichen Verschlechterung des Zustands des Patienten. Um solche Blutungen trotz des ernsten Zustands des Patienten zu stoppen, wird eine Notfall-Nachoperation (Relaparotomie oder Rethorakotomie) durchgeführt.
Wie zu prüfen?
Behandlung Hämorrhagien
Man unterscheidet zwischen spontaner und künstlicher Blutstillung. Eine spontane Blutstillung tritt auf, wenn kleinkalibrige Gefäße durch Spasmen und Thrombosen geschädigt werden. Verletzungen großkalibriger Gefäße erfordern therapeutische Maßnahmen. In diesen Fällen wird die Blutstillung in eine vorübergehende und eine endgültige unterteilt.
Die vorübergehende Blutstillung rechtfertigt nicht immer ihren Namen, da die dafür ergriffenen Maßnahmen bei Verletzungen mittelgroßer, insbesondere venöser Gefäße oft einen endgültigen Stopp bewirken. Maßnahmen zur vorübergehenden Blutstillung umfassen eine erhöhte Position der Extremität, einen Druckverband, maximale Beugung des Gelenks, Fingerdruck auf das Gefäß, das Anlegen eines Tourniquets, das Anbringen einer Klemme am Gefäß und das Belassen in der Wunde.
Das in der Physiotherapie am häufigsten angewandte Verfahren zur Blutstillung ist die Anwendung von Kälte.
Bei dieser Maßnahme wird eine Kompresse – ein Beutel mit Eis – auf die betroffene Stelle aufgetragen, um die Blutgefäße in der Haut und den inneren Organen in diesem Bereich zu verengen. Dadurch treten folgende Prozesse auf:
- Die Blutgefäße der Haut verengen sich reflexartig, was zu einem Absinken der Hauttemperatur, einer Blässe der Haut, einer verminderten Wärmeübertragung und einer Umverteilung des Blutes zu den inneren Organen führt.
- Die Blutgefäße in der Haut erweitern sich reflexartig: Die Haut wird rosarot und fühlt sich warm an.
- Die Kapillaren und Venolen weiten sich, die Arteriolen verengen sich; die Blutflussrate nimmt ab; die Haut wird rot und kalt. Anschließend verengen sich die Gefäße, es kommt zu einer regionalen Abnahme der Blutung, der Stoffwechsel verlangsamt sich und der Sauerstoffverbrauch sinkt.
Die Ziele des Kälteverfahrens:
- Entzündungen reduzieren.
- Reduzieren (begrenzen) Sie traumatische Schwellungen.
- Stoppen (oder verlangsamen) Sie die Blutung.
- Betäuben Sie den betroffenen Bereich.
Der Druckverband wird wie folgt angelegt: Die verletzte Extremität wird hochgelagert. Eine sterile Watterolle wird auf die Wunde gelegt und fest verbunden. Die hochgelagerte Extremität bleibt erhalten. Durch die Kombination dieser beiden Techniken können venöse Blutungen erfolgreich gestillt werden.
Bei einer Gefäßschädigung im Ellenbogenbereich oder in der Kniekehle kann die Blutung durch eine maximale Beugung des Gelenks und Fixierung dieser Position mit einem Weichteilverband vorübergehend gestoppt werden.
Bei einer Schädigung der Hauptschlagadern kann die Blutung kurzzeitig durch Drücken des Gefäßes mit den Fingern gegen den darunterliegenden Knochen gestoppt werden. Diese Art der Blutstillung (aufgrund der rasch einsetzenden Ermüdung der Hände der helfenden Person) kann jedoch nur wenige Minuten anhalten, daher sollte so schnell wie möglich eine Aderpresse angelegt werden.
Die Regeln für das Anlegen einer Aderpresse lauten wie folgt. Die verletzte Extremität wird hochgehoben und oberhalb der Wunde in ein Handtuch gewickelt, auf das die Aderpresse aufgebracht wird. Die Aderpresse kann eine Standard- (Esmarch-Gummi-Aderpresse) oder eine improvisierte Aderpresse (ein Stück dünner Gummischlauch, Gürtel, Seil usw.) sein. Eine Gummi-Aderpresse muss vor dem Anlegen kräftig gedehnt werden. Bei korrektem Anlegen der Aderpresse verschwindet der Puls im distalen Teil der Extremität. Da die Aderpresse maximal 2 Stunden an der Extremität angelegt wird, ist es notwendig, den Zeitpunkt der Aderpresse zu notieren, auf einem Blatt Papier festzuhalten und an der Aderpresse zu befestigen. Der Patient muss in Begleitung einer medizinischen Fachkraft in eine medizinische Einrichtung transportiert werden. Die endgültige Blutstillung kann auf verschiedene Weisen erreicht werden: mechanisch, thermisch, chemisch und biologisch.
Mechanische Methoden zur endgültigen Blutstillung umfassen Tamponade, Ligatur des Gefäßes in der Wunde oder entlang seiner Länge sowie Gefäßnaht. Die Blutstillung mit einem Mulltampon wird bei Kapillar- und Parenchymblutungen angewendet, wenn andere Methoden nicht anwendbar sind. Nach einer Gefäßthrombose (nach 48 Stunden) ist es ratsam, den Tampon zu entfernen, um eine Infektion zu vermeiden. Die Ligatur des Gefäßes in der Wunde muss unter Sichtkontrolle erfolgen. Das blutende Gefäß wird mit einer hämostatischen Klemme gefasst, an der Basis mit einem Knoten ligiert, die Klemme wird entfernt und ein zweiter Knoten wird gebunden. Manchmal ist die Blutungsquelle durch eine starke Muskelmasse verborgen, beispielsweise im Gesäßbereich. Die Suche danach ist mit einem zusätzlichen erheblichen Trauma verbunden. In solchen Fällen wird das Gefäß der Länge nach ligiert (Arteria iliaca interna). Ähnliche Eingriffe werden bei späten Nachblutungen aus einer eitrigen Wunde durchgeführt. Eine Gefäßnaht wird angewendet, wenn die Enden eines durchtrennten Gefäßes vernäht oder der zerquetschte Abschnitt durch ein Transplantat oder eine Endoprothese ersetzt wird. Handnähte werden mit Seidenfäden verwendet oder mit speziellen Geräten durchgeführt, die die Enden des gerissenen Gefäßes mit Tantalklammern befestigen.
Thermische Methoden umfassen die Einwirkung niedriger und hoher Temperaturen auf blutende Gefäße. Um die Bildung von intermuskulären Hämatomen und Hämarthrosen zu verhindern, wird die Haut am häufigsten durch Kältebehandlung in Form von Eisbeuteln, Spülungen mit Ethylchlorid, kalten Kompressen usw. behandelt. Kapillare und parenchymatöse Blutungen lassen sich durch Kompressen mit heißer 0,9%iger Natriumchloridlösung gut stillen. Die Elektrokoagulation mittels Diathermie bietet eine gute Blutstillung bei Blutungen aus kleinen und mittelgroßen Gefäßen.
Chemische Methoden zur Blutstillung umfassen die Verwendung von Vasokonstriktoren und Blutgerinnungsmitteln, die sowohl lokal als auch intravenös angewendet werden. Am gebräuchlichsten sind Lotionen und Wundspülungen mit Wasserstoffperoxidlösungen, 0,1%iger Adrenalinlösung, Calcium- und Natriumchloriden. 10%ige Calciumchloridlösung, 5%ige Ascorbinsäurelösung, 4%ige Aminocapronsäurelösung usw. werden intravenös verabreicht.
Biologische Methoden zur Blutstillung werden hauptsächlich bei Kapillar- und Parenchymblutungen eingesetzt. Ursache für solche Blutungen sind chirurgische Eingriffe, die mit der Trennung ausgedehnter Adhäsionskonglomerate und Schäden an parenchymatösen Organen (Leber, Nieren) verbunden sind. Alle Methoden zur biologischen Blutstillung lassen sich in folgende Gruppen einteilen:
- Tamponade einer blutenden Wunde mit thrombokinasereichem autologem Gewebe (Omentum, Muskel, Fettgewebe, Faszie); die Tamponade wird mit einem freien Stück Omentum, Muskel oder einem gestielten Transplantat durchgeführt und an den Wundrändern vernäht;
- Transfusion kleiner Dosen (100–200 ml) roter Blutkörperchenmasse, Plasma;
- Einführung von Menadion-Natriumbisulfit und 5%iger Ascorbinsäurelösung;
- lokale Anwendung von Blutderivaten (Fibrinfilm, blutstillender Schwamm usw.): Sie werden in die Wunde eingeführt und dort belassen, nachdem sie vernäht wurde.
Bei akuter Anämie muss das Volumen des Blutverlustes bestimmt werden. Es kann auf folgende Weise näherungsweise bestimmt werden.
Basierend auf dem klinischen Bild.
- Es liegen keine hämodynamischen Störungen vor – der Blutverlust beträgt bis zu 10 % des zirkulierenden Blutvolumens.
- Blasse Haut, Schwäche, Herzfrequenz bis zu 100 pro Minute, Blutdruckabfall auf 100 mmHg – Blutverlust bis zu 20 % des zirkulierenden Blutvolumens.
- Starke Blässe der Haut, kalter Schweiß, Adynamie, Herzfrequenz bis zu 120 pro Minute, Blutdruck unter 100 mmHg, Oligurie – Blutverlust bis zu 30 % des zirkulierenden Blutvolumens.
- Bewusstseinsstörungen, Herzfrequenz bis zu 140 Schlägen pro Minute, Blutdruck unter dem kritischen Wert, Anurie – Blutverlust von mehr als 30 % des zirkulierenden Blutvolumens.
- Bei Frakturen des Schienbeins beträgt der Blutverlust üblicherweise 0,5–1 l, beim Oberschenkel 0,5–2,5 l und beim Becken 0,8–3 l.
Die Höhe des Blutverlustes kann nur durch Laboruntersuchungen zuverlässig bestimmt werden (mithilfe von Tabellen oder Nomogrammen, die Blutdruck, BCC, Hämatokrit, spezifisches Gewicht des Blutes usw. berücksichtigen).
Ein akuter Blutverlust sollte sofort ausgeglichen werden. Bei einem Hämoglobinwert von 100 g/l und einem Hämatokritwert von 30 % ist eine Transfusion von Blutprodukten angezeigt.

