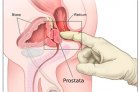Computertomographie der Prostata
Einer der wichtigsten Vorteile der CT der Prostata ist die relativ geringe Bedienerabhängigkeit der Methode: Die Ergebnisse einer nach einer Standardprozedur durchgeführten Befragung können von verschiedenen Spezialisten ohne erneute Überprüfung überprüft und interpretiert werden.
Vorteile der Multispiral-Computertomographie der Prostata:
- hohe räumliche Auflösung;
- hohe Geschwindigkeit der Forschung;
- die Möglichkeit der dreidimensionalen und mehrschichtigen Rekonstruktion von Bildern;
- geringe Bedienerabhängigkeit der Methode;
- die Möglichkeit, die Forschung zu standardisieren;
- relativ hohe Verfügbarkeit der Ausrüstung (nach der Anzahl der Geräte und der Kosten der Umfrage).
Zweck der Computertomographie der Prostata
Das Hauptziel des CT-Scans ist es, das Stadium der regionalen Prävalenz von Prostatakrebs zu bestimmen (vor allem bei der Erkennung von metastatischen Läsionen der Lymphknoten).
Indikationen für die Computertomographie der Prostata
Die Hauptindikationen für die Durchführung der MSCT der Beckenorgane:
- Nachweis der regionalen Lymphadenopathie bei Patienten mit nachgewiesenem Prostatakrebs;
- Aufdecken der Ausbreitung des Tumors auf die Beckenorgane bei Patienten mit hohem Risiko für lokale Onko-Proliferation (PSA-Wert> 20 ng / ml, die Summe der Werte für Gleason ist 8-10);
- Planung der Strahlentherapie.
Um Fernmetastasen zu erkennen, werden CT von Lunge, Gehirn, Leber und Nebennieren durchgeführt.
Vorbereitung für die Computertomographie der Prostata
Vorbereitung von Patienten für MSCT Becken- und Bauch umfasst kontras oral Dünn- und Dickdarm positive oder negative Substanz, die für eine genaue Differenzierung von Lymphknoten und Darmschlingen als positive Kontrastmittel verwendet amidotrizoat 3-4% Natriumchlorid (Urografin) oder Hypaque ( 40 ml Kontrastmittel pro 1000 ml Wasser), wird es in 2 Portionen von 500 ml getrennt und nimmt am Abend vor der Studie und am Morgen der Studie. Als negatives Kontrastmittel kann Wasser (1500 ml für 1 h vor dem Test) verwendet werden, die bei der MDCT mit intravenösem Kontrast und dreidimensionaler Nachbildung des Bildes besonders wichtig ist.
Die MSCT des kleinen Beckens wird mit einer gefüllten Blase durchgeführt. Einige Forscher schlagen vor, das Rektum mit einem Kontrastmittel oder einem aufgeblasenen Ballon zu füllen. Die MSCT der Bauchhöhle und des Retroperitonealraumes kann mindestens 3-4 Tage nach der röntgenologischen Untersuchung des Verdauungstraktes mit Bariumsulfat wegen möglicher CT-Artefakte durchgeführt werden.
ICSD mit intravenösem Kontrast bei Patienten mit Risikofaktoren für Kontrast-induzierte Nephropathie (diabetische Nephropathie, Dehydrierung, kongestiver Herzinsuffizienz, Alter über 70 Jahre) kann nur nach entsprechender Vorbereitung als orale oder intravenöse Hydrierung (2,5 Liter Flüssigkeit für 24 durchgeführt werden, h vor dem Studium). Der Eintritt von nephrotoxischen Arzneimitteln (NSAIDs, Dipyridamol, Metformin) wie möglich sollte 48 Stunden vor abgesetzt wird MDCT mit intravenösem Gegensatz zur Durchführung.
Methode für das Studium der Computertomographie der Prostata
Wenn die MSCT durchgeführt wird, wird der Patient mit erhobenen Armen auf den Rücken gelegt. Gynäkologische Untersuchung und zabryushiinogo Raum (Abtastbereich - von der Membranen auf die Pobacken) durchgeführt wird Röntgenstrahl Kollimation von 0,5-1,5 mm, die Rekonstruktion von Dünnschnitten von 1,5-3 mm in drei Ebenen, in Ansicht von Tomogrammen des Weichgewebes und Knochenfenster.
Intravenöse Kontrastierung ist notwendig, um die Grenzen des Tumors zu klären und das Eindringen von umgebenden Strukturen zu identifizieren. Kontrastmittel (Iodkonzentration von 300-370 mg pro 1 ml) wurde mittels einer automatischen Injektors in einem Volumen von 100-120 ml mit einer Rate von 3-4 ml / s injiziert und durch die Verabreichung von etwa 50 ml Kochsalzlösung folgte. Becken Studie beginnt mit einer Verzögerung von 25 bis 30 Sekunden nach dem Start von intravenösen Kontrastmitteln Bilder in der frühen arteriellen Phase des Kontrastes bereitzustellen, verwendet werden kann, zusätzlich Zwischenphasenkontrast (60-70 zu verzögern), informative Tumorgrenzen zu bewerten .
Kontraindikationen für die Computertomographie der Prostata
Absolute Kontraindikationen für den CT-Scan der Prostata gibt es nicht. Patienten mit schweren allergischen Reaktionen auf jodhaltige Kontrastmittel in der Anamnese sind bei der Durchführung einer CT mit intravenösem Kontrastmittel kontraindiziert.
Interpretation der Ergebnisse der Computertomographie der Prostata
Die normale Prostata
Bei MSCT hat es eine gleichmäßige Dichte (manchmal mit feinen Kalzinierungen) ohne Zonendifferenzierung.
Das Drüsenvolumen wird anhand der Ellipsenformel berechnet:
V (mm 3 oder ml) = x • y • z • π / 6, wobei x die Querdimension ist; y - anteroposteriore Größe; z ist die vertikale Dimension; π / 6 - 0,5.
Normalerweise haben die Samenbläschen eine röhrenförmige Struktur, symmetrisch, bis zu 5 cm groß, getrennt von der Blase durch eine Schicht von Fettgewebe, deren Fehlen als ein Kriterium für Tumorinvasion dient.
Benigne Prostatahyperplasie
Identifizieren Zunahme des Prostatavolumens (20 cm 3 ) auf Grund der Proliferation von Knoten lacunar Zonen , die bei einigen Patienten vputripuzyrnym Wachstum begleitet. Ferner wurde während MSCT mit intravenösem Kontrast in sekretorischer Phase (nach 5-7 min nach der Arzneimittelverabreichung) Elevation distale Harnleiter offenbaren können (aufgrund einer Zunahme des Prostatavolumens), trabekulären Wand und Divertikeln infolge Hypertrophie der Harnblasen Detrusor als Reaktion auf eine partielle Urethralobstruktion. Wenn die Miktion Mehrschicht- cystourethrography nachdem die Blase Kontrastmittel füllte es Urethra Striktur identifiziert sichtbar gemacht werden kann.
Adenokarzinom der Prostata
Foki des Adenokarzinoms innerhalb der Prostata können durch die aktive Ansammlung eines Kontrastmittels in der arteriellen Phase (25-30 Sekunden vom Zeitpunkt der intravenösen Verabreichung) nachgewiesen werden. Die extraproströse Ausbreitung von Prostatakrebs kann mit lokaler Schwellung, oft mit einer asymmetrischen Zunahme der Samenblase und dem Verschwinden von Flüssigkeitsinhalten, nachgewiesen werden. CT-Zeichen der Invasion benachbarter Organe und Strukturen (Blase, Rektum, Muskel- und Beckenwand) - das Fehlen einer Differenzierung der Fettgewebsschichten.
Die Beurteilung von Becken- und retroperitonealen Lymphknoten mit Hilfe von MSCT basiert auf der Definition ihrer quantitativen und qualitativen Veränderungen. Mit Methol lassen sich die typischen Zonen ihrer Läsion beim Prostatakarzinom sichtbar machen (obstruktive, interne und externe iliakale Gruppen). Obstruktive Lymphknoten werden auf die mediale Kette der äußeren Iliakalgruppe bezogen; Sie haben ein Schwules an der Seitenwand des Beckens auf der Höhe des Acetabulums. Das zentrale CT-Zeichen der Lymphadenopathie ist die Größe der Lymphknoten. Die obere Grenze der CT-Norm ist der transversale (kleinste) Durchmesser des Lymphknotens, gleich 15 mm. Die Sensitivität und Spezifität der CT bei der Detektion von Lymphadenopathie variiert jedoch von 20 bis 90%, da die Methode Metastasen in unwichtigen Lymphknoten nicht nachweisen kann und oft falsch-negative Ergebnisse liefert.
Analyse Tomogramme Becken- und Retroperitonealraums muss das Betrachten von Bildern im Knochenfenster enthalten, die Sie Taschen der Osteosklerose giperdensnye entsprechenden typischen osteoblastische Metastasen von Prostatakrebs im Becken, Lenden- und Brustwirbelsäule, Hüftknochen, Rippen zu identifizieren.
Betriebseigenschaften
MSCT erlaubt es nicht, die Zonenanatomie zu unterscheiden und die Prostatakapsel zu visualisieren, was die Möglichkeiten dieser Methode beim Nachweis von PCa und der Bestimmung der lokalen Prävalenz des Onkoprozesses einschränkt. Die hohe Häufigkeit von falsch negativen Ergebnissen von MSCT im Staging von PCa ist darauf zurückzuführen, dass das Stadium T3 nur bei Vorliegen eines großen Tumors mit extra-prostatischem Wachstum und Beteiligung der Samenbläschen etabliert ist. Der Nachweis des Stadiums T3a, insbesondere mit begrenztem extrakapsulärem Tumorwachstum, oder die anfängliche Beteiligung von Samenbläschen mit MSCT ist nahezu unmöglich. MSCT ist nicht ausreichend informativ bei der Beurteilung der Wirksamkeit von Prostatakrebs Behandlung und Erkennung von lokalen Rückfall.
Komplikationen der Computertomographie der Prostata
Die moderne MSCT-Prostata ist eine nahezu sichere Diagnosemethode, die für die meisten Patienten akzeptabel ist. Die Entwicklung von iodhaltigen Kontrastmittelpräparaten, das Auftreten von nichtionischen Wirkstoffen (Iopromid, Jogexol) ging mit einer 5-7-fachen Abnahme der Häufigkeit schwerer Nebenwirkungen einher. Aus diesem Grund wurde MSCT mit intravenöser Kontrastmittel als ambulante Untersuchungsmethode zur Verfügung gestellt. Trotz der geringeren Kosten für ionische Kontrastmittel im Vergleich zu nicht-ionischen Wirkstoffen wurden letztere Ende der 90er Jahre zu den bevorzugten Medikamenten der MSCT. XX Jahrhundert. Bei Verwendung von nicht-ionischen Kontrastmitteln bei mäßigen allergischen Reaktionen in der Anamnese kann Premedisolon (30 mg per os für 12 und 2 Stunden vor der Studie) vorbehandelt werden.
Aussichten für die Computertomographie der Prostata
Perspektiven für die Entwicklung von CT Diagnose von Prostatakrebs bei der Verwendung von Mehrschicht- assoziiert sind (64-256) -Bildgebung, ermöglicht in allen Ebenen, eine Studie mit Schichtdicke von etwa 0,5 mm isotropen Voxeln, und eine Bildrekonstruktion durchzuführen. Dank einer Erhöhung der Geschwindigkeit der Tomographie wird es möglich, eine Perfusions-MSCT der Prostatadrüse mit dem Nachweis von Foki der Tumor-Neoangiogenese durchzuführen. Gegenwärtig wird eine Perfusionsbeurteilung mittels MRT mit intravenösem Kontrast oder Ultraschall durchgeführt.
Andere Artikel zum Thema
Pathologische Störungen im Prostatagewebe können nur bei der Ultraschalluntersuchung erkannt werden und sind als diffuse Veränderungen in der Prostata definiert.