Neue Veröffentlichungen
Wie ein Antikörper sein Ziel „wiederaufbaut“: Warum manche Anti-CD20-Antikörper Komplement benötigen, während andere direkt töten
Zuletzt überprüft: 18.08.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
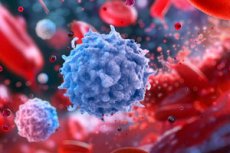
Wissenschaftler haben visualisiert, was genau mit dem CD20-Rezeptor auf B-Zellen passiert, wenn therapeutische Antikörper (Rituximab, Obinutazumab usw.) daran binden. Mithilfe einer neuen Version der RESI-Superauflösungsmikroskopie konnten sie dies in ganzen lebenden Zellen auf der Ebene einzelner Proteine beobachten und das Muster der Nanocluster mit verschiedenen Wirkmechanismen von Medikamenten verknüpfen. Das Ergebnis: Antikörper vom Typ I (z. B. Rituximab, Ofatumumab) bauen CD20 zu langen Ketten und Überstrukturen zusammen – dadurch wird das Komplement besser „eingepflanzt“. Antikörper vom Typ II (z. B. Obinutazumab) beschränken sich auf kleine Oligomere (bis hin zu Tetrameren) und bieten eine stärkere direkte Zytotoxizität und Abtötung durch Effektorzellen. Die Arbeit wurde in Nature Communications veröffentlicht.
Hintergrund der Studie
- Warum CD20? Anti-CD20-Antikörper sind das Mittel der Wahl bei der Behandlung von B-Zell-Lymphomen/Leukämien und einigen Autoimmunerkrankungen. Es gibt verschiedene Medikamente auf dem Markt, die sich jedoch in der Zelle unterschiedlich verhalten und unterschiedliche klinische Profile erzeugen.
- Zwei mechanistische Lager. Konventionell gibt es Antikörper vom Typ I (Rituximab, Ofatumumab) und Typ II (Obinutazumab etc.). Erstere beinhalten eher Komplement (CDC), letztere sorgen häufiger für direkten Zelltod und Abtötung durch Effektorzellen (ADCC/ADCP). Aus der Biochemie und funktionellen Tests ist dies schon lange bekannt – warum genau dies auf Nanometerebene so ist, war jedoch unklar.
- Was den bisherigen Methoden fehlte.
- Mit der klassischen Immunfluoreszenz und sogar vielen superauflösenden Ansätzen lassen sich keine „einzelnen Moleküle“ in einer lebenden Membran erkennen, wenn die Ziele dicht gepackt und dynamisch sind.
- Kryo-EM liefert erstaunliche Details, allerdings meist außerhalb des Kontexts einer ganzen lebenden Zelle.
Daher musste die „Geometrie“ von CD20 unter dem Antikörper (welche Cluster, Ketten, Größen) anhand indirekter Daten erraten werden.
- Warum Geometrie wichtig ist. Komplement wird aktiviert, wenn C1q gleichzeitig korrekt positionierte Fc-Domänen erfasst – es ist buchstäblich eine Frage von Entfernungen und Winkeln. Ebenso hängt die Effizienz von ADCC/ADCP davon ab, wie der Antikörper sein Fc den Effektorzellrezeptoren aussetzt. Die Nanoarchitektur von CD20+Antikörper ist also der Schlüssel zur Funktion.
- Was war das Ziel der Autoren? In ganzen lebenden Zellen (in situ) zu zeigen, was genau verschiedene Anti-CD20 mit CD20 machen: welche Oligomere und Überstrukturen entstehen, wie dies mit der Komplementinkorporation und -abtötung zusammenhängt und ob es möglich ist, die Mechanik durch Antikörperdesign (Bindungswinkel, Scharniere, Valenz, bispezifische Antikörper) zu steuern.
- Warum ist dies in der Praxis notwendig?
- Design der nächsten Generation: Lernen, die „Griffe“ einer Struktur zu optimieren, um den gewünschten Wirkungsmechanismus für eine bestimmte klinische Aufgabe oder einen Tumorkontext zu erhalten.
- Sinnvolle Kombinationen: Verstehen Sie, wo ein „komplementäres“ Medikament und wo ein „direkter Killer“ besser geeignet ist.
- Qualitätskontrolle/Biosimilars: verfügen über einen physischen „Fingerabdruck“ der korrekten Clusterung als Biomarker der Gleichwertigkeit.
Kurz gesagt: Therapeutische Antikörper wirken nicht nur „nach dem Rezept des Mechanismus“, sondern auch nach der Geometrie, die die Ziele der Membran auferlegen. Vor dieser Arbeit hatten wir kein Werkzeug, um diese Geometrie in einer lebenden Zelle mit der Genauigkeit einzelner Moleküle zu sehen – diese Lücke schließen die Autoren.
Warum war das notwendig?
Anti-CD20-Antikörper bilden die Grundlage der Therapie von B-Zell-Lymphomen und Leukämien und dienen bei einigen Autoimmunerkrankungen als Mittel zur „Abschaltung“ von B-Zellen. Wir wussten, dass „Typ I“ und „Typ II“ unterschiedlich wirken (Komplement versus direkte Abtötung), aber wie sich dieser Unterschied auf Nanometerebene in der Zellmembran darstellt, war unklar. Klassische Methoden (Kryo-EM, STORM, PALM) in lebenden Zellen erreichten für dichte, dynamische Komplexe nicht die Auflösung eines „Proteins“. RESI schafft dies.
Was haben sie getan?
- Wir verwendeten Multi-Target-3D-RESI (Resolution Enhancement by Sequential Imaging) und DNA-PAINT-Markierung, um CD20 und die damit verbundenen Antikörper gleichzeitig in der Membran ganzer Zellen hervorzuheben. Die Auflösung ist die Ebene einzelner Moleküle in einem In-situ-Kontext.
- Wir verglichen Typ I (Rituximab, Ofatumumab usw.) und Typ II (Obinutazumab; sowie Klon H299) und analysierten quantitativ, welche CD20-Oligomere sie bilden – Dimere, Trimere, Tetramere und höhere.
- Wir testeten die Beziehung zwischen dem „Muster“ und der Funktion: Wir maßen die Komplementbindung, die direkte Zytotoxizität und die Abtötung durch Effektorzellen. Wir experimentierten auch mit der Geometrie der Antikörper (Beispiel: Umdrehen der Fab-Arme im CD20×CD3 T-Zell-Engager), um zu verstehen, wie die Flexibilität/Ausrichtung des Scharniers die Funktion zwischen Typ I und II verschiebt.
Die wichtigsten Erkenntnisse in einfachen Worten
- Typ I bildet Ketten und „Plattformen“ von CD20 – mindestens Hexamere und länger; diese Geometrie ist für C1q praktisch, sodass Komplement besser eingeschlossen wird. Beispiele: Rituximab, Ofatumumab.
- Typ II ist auf kleine Ansammlungen beschränkt (normalerweise bis zu Tetrameren), weist jedoch eine höhere direkte Zytotoxizität und eine stärkere Abtötung durch Effektorzellen auf. Beispiel: Obinutazumab.
- Die Geometrie ist entscheidend. Verändert man die Flexibilität/Ausrichtung der Fab-Arme des bispezifischen Antikörpers CD20xCD3, verschiebt sich sein Verhalten von „Typ II“ zu „Typ I“: CD20-Clusterbildung ↑ und direkte Zytotoxizität ↓ – eine klare Struktur-Funktions-Beziehung.
Warum ist das für die Therapie wichtig?
- Design der nächsten Generation: Es ist jetzt möglich, Antikörper speziell für einen gewünschten Mechanismus (mehr Komplement oder direktere Abtötung) zu entwickeln, indem Bindungswinkel, Scharniere und Valenz angepasst werden, um die gewünschte CD20-Nanoarchitektur zu erreichen.
- Personalisierung und Kombinationen. Wenn der Komplementweg bei einem bestimmten Tumor besser funktioniert, lohnt es sich, zu „Typ I“ (oder Antikörpern/bispezifischen Antikörpern, die lange CD20-Ketten bilden) zu greifen. Wenn der direkte Tod wichtiger ist, wählen Sie „Typ II“ und ergänzen Sie ihn durch Effektorwege.
- Qualitätskontrolle und Biosimilars. RESI bietet effektiv einen Geometrietest: Ein Modell kann trainiert werden, um die „Signatur“ der richtigen CD20-Oligomere zu erkennen und als biophysikalische Kontrolle bei der Entwicklung von Biosimilars zu verwenden.
Ein bisschen Mechanik (für Interessierte)
Laut Kryo-EM und neuen Bildern bindet Typ I (z. B. Rituximab) in einem flachen Winkel an CD20, überbrückt CD20-Dimere und bildet Ketten mit Plattformen für C1q; Ofatumumab bewirkt etwas Ähnliches, allerdings mit einem kleineren Schritt in der Kette und „pflanzt“ die Komplementierung noch stabiler. Typ II (Obinutazumab) hat einen steileren Winkel und eine andere Stöchiometrie (1 Fab zu 2 CD20), sodass es in der Trimer-Tetramer-Zone verbleibt.
Einschränkungen und was als nächstes kommt
- Dabei handelt es sich um Zellmodelle mit sorgfältig kontrollierten Bedingungen. Der nächste Schritt besteht darin, wichtige CD20-Clustermuster in primären Tumorproben zu bestätigen und sie mit der klinischen Reaktion zu korrelieren.
- RESI ist eine komplexe Technik, das Team betont jedoch ihre Vielseitigkeit: Sie kann jedes Membranziel und seine Antikörper – von EGFR/HER2 bis PD-L1 – abbilden und auch die Nanoarchitektur mit der Funktion verknüpfen.
Abschluss
Antikörper wirken nicht nur „nach dem Rezept des Mechanismus“, sondern auch nach der Geometrie, die sie dem Rezeptor in der Membran aufzwingen. Es ist möglich geworden, diese Geometrie zu sehen – und dies eröffnet den Weg für ein präziseres Design von Immunpräparaten, bei denen der gewünschte klinische Effekt auf Nanometerebene festgelegt wird.
Forschungsquelle: Pachmayr I. et al. Auflösung der strukturellen Grundlagen der therapeutischen Antikörperfunktion in der Krebsimmuntherapie mit RESI. Nature Communications, 23. Juli 2025. doi.org/10.1038/s41467-025-61893-w
