Neue Veröffentlichungen
Experimentelle Therapie könnte zu einem universellen antiviralen Medikament führen
Zuletzt überprüft: 18.08.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
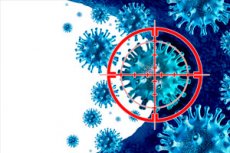
In Science Translational Medicine wird eine experimentelle antivirale Breitbandtherapie beschrieben: Ein Satz von zehn Interferon-induzierbaren Genen (ISGs) wird über mRNA in Lipidnanopartikeln in Zellen eingebracht. Dieses kurzfristige „Anschalten“ antiviraler Proteine stoppte die Virusreplikation in Zellkulturen und schwächte die Krankheit bei Hamstern und Mäusen ab, die mit Influenza und SARS-CoV-2 infiziert waren. Die Wirkung hält etwa drei bis vier Tage an und soll einen schnellen Schutz vor Ausbrüchen unbekannter Viren bieten.
Hintergrund
Warum überhaupt ein „universelles“ antivirales Mittel?
Klassische Medikamente und Impfstoffe zielen in der Regel auf ein bestimmtes Virus und/oder einen bestimmten Stamm ab. Dies hinterlässt in den ersten Wochen nach dem Ausbruch neuer Erreger und bei der Entstehung von Resistenzen eine Lücke. Daher wächst das Interesse an wirtsgerichteten antiviralen Medikamenten – Medikamenten, die die Abwehrmechanismen des Wirtes aktivieren oder anpassen und so ein breites Wirkspektrum bieten. Solche Ansätze sind für Virusmutationen potenziell schwieriger zu umgehen und könnten funktionieren, bis zielgerichtete Medikamente und Impfstoffe verfügbar sind.
Interferonschutz und ISG bilden den natürlichen „Schutzschild“ der Zelle.
Typ-I-Interferone lösen die Expression von Hunderten Interferon-induzierten Genen (ISG) aus, deren gemeinsame Wirkung das Virus in verschiedenen Stadien des Lebenszyklus unterdrückt. Für viele ISG sind die Mechanismen bekannt (MxA, OAS/RNase L, IFIT usw.), für einige werden sie noch untersucht, aber das Prinzip der „multifaktoriellen Mauer“ ist gut etabliert. Die Idee, den Kern dieses Programms synthetisch „vorübergehend einzuschalten“, erscheint logisch.
Ein menschliches „Naturexperiment“: ISG15-Mangel.
Beobachtungen an Menschen mit vererbtem ISG15-Mangel legten die zentrale Hypothese der neuen Arbeit nahe: In menschlichen Zellen hebt das Fehlen von ISG15 die Hemmung des USP18-Regulators auf und führt zu einem verlängerten IFN-I-Signal; solche Zellen weisen eine erhöhte Resistenz gegen eine Reihe von Viren auf (in Kultur und Primärzellen). Dies unterscheidet sich von Mäusen und unterstreicht die Speziesspezifität des Interferon-Netzwerks.
Warum ein mRNA-„Cocktail“ aus mehreren ISGs?
Einzelne ISGs wirken auf verschiedene Knotenpunkte des Viruszyklus; eine Kombination mehrerer Gene bildet theoretisch eine additive/synergistische Barriere und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus „durchschlüpft“. Präzedenzfälle für das breite antivirale Potenzial einzelner ISGs wurden bereits beschrieben, doch die parallele Expression von „Dutzenden“ wichtiger ISGs ist ein Versuch, die Zelle dem physiologischen Zustand der „Interferonbereitschaft“ näher zu bringen, ohne systemische IFN-Gabe und dessen Nebenwirkungen.
Lungenverabreichung: Warum sie schwierig und relevant ist.
Bei Atemwegsviren ist ein lokaler Schutz in den Atemwegen optimal. Lipidnanopartikel (LNPs) sind eine bewährte Plattform für die mRNA-Verabreichung, die intranasale/inhalative Verabreichung stellt jedoch besondere Anforderungen: Stabilität während der Aerosolisierung, Passage durch Schleim und Tenside, „Feinabstimmung“ der Zusammensetzung (z. B. PEG-Lipid) und der Verabreichungsart. Dies wurde in den letzten Jahren intensiv untersucht.
Wie unterscheidet sich diese neue Arbeit von früheren Arbeiten?
Die Autoren von Science Translational Medicine stellten einen Multi-mRNA-Cocktail aus zehn ISGs in einer einzigen LNP-Formel zusammen, verabreichten ihn lokal in die Atemwege von Nagetieren und demonstrierten einen kurzfristigen (ca. 3–4 Tage) Breitband-„antiviralen Zustand“ gegen Influenza und SARS-CoV-2 – sowohl prophylaktisch als auch mit therapeutischer Wirkung im Modell. Konzeptionell schlägt dies eine Brücke zu den Anfängen des Ausbruchs, obwohl es noch keine spezifische Therapie gibt.
Einschränkungen des Ansatzes und Fragen für die Zukunft.
Dieser Ansatz befindet sich noch im präklinischen Stadium (Zellen, Mäuse, Hamster). Erforderlich sind eine Optimierung der Lungenabgabe, toxikologische Untersuchungen, die Häufigkeit der „Aufladung“ des Schutzes ohne übermäßige Entzündung und die Kompatibilität mit der Bildung einer adaptiven Immunität. Der wirtsgerichtete Bereich entwickelt sich aktiv, erfordert jedoch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Effizienz und Sicherheit.
Eine Idee, inspiriert durch einen seltenen Immundefekt
Grundlage sind Beobachtungen an Menschen mit ISG15-Mangel: Ihr Typ-I-Interferon-Signalweg ist chronisch leicht aktiviert und ihre Zellen sind überraschend resistent gegen viele Viren. Das Team von Duchamp Bogunovic entschied sich, ISG15 nicht abzuschalten (was Dutzende von Nebenwirkungen hätte), sondern gezielt ein Dutzend wichtiger ISGs „anzuschalten“, die den wichtigsten antiviralen Schutzschild bilden.
So funktioniert der Prototyp
- Ein Lipid-Nanopartikel enthält 10 mRNAs, die ausgewählte ISGs kodieren.
- Nachdem sie in die Zellen eingedrungen sind, synthetisieren sie für mehrere Stunden oder Tage zehn „Wächter“ der angeborenen Immunität und erzeugen so einen vorübergehenden antiviralen Zustand.
- Kernidee: niedrige Dosis und kurze Expression → weniger Entzündung als bei Menschen mit dem angeborenen ISG15-Defekt, aber genug, um das Virus in Schach zu halten.
Was wurde in der Arbeit gezeigt
- In vitro: Schutz der Zellen vor verschiedenen Viren; die Autoren haben „noch kein Virus gefunden, das eine solche Barriere durchbrechen könnte“ (Vorsicht: es handelt sich um Zellkultur).
- In vivo (Nagetiere): Bei prophylaktischer Verabreichung als Tropfen „in die Lunge durch die Nase“ reduzierte das Medikament die Replikation und Schwere der Krankheit während einer Grippe- und SARS-CoV-2-Infektion.
- Dauer: Schutz für etwa 3–4 Tage; die Autoren positionieren dies als „Brücke“ für Risikogruppen (medizinisches Personal, Pflegeheime, Familien von Patienten) in den ersten Tagen des Ausbruchs.
Warum ist das wichtig?
Die meisten antiviralen Medikamente und Impfstoffe sind spezifisch gegen einen einzigen Erreger gerichtet. Der wirtsabhängige Genansatz bietet die Chance auf ein breites Wirkspektrum – auch wenn der Erreger noch nicht identifiziert ist. Gleichzeitig beeinträchtigt die vorübergehende Aktivierung des angeborenen Schutzes nicht die Bildung einer Erinnerung (adaptive Immunität) gegen das Virus selbst.
Einschränkungen und offene Fragen
- Derzeit handelt es sich um eine präklinische Studie: Zellen, Mäuse, Hamster. Bis wir Menschen erreichen, ist es noch ein weiter Weg.
- Die Abgabe an die Lunge stellt einen Engpass dar: Wir müssen die Effizienz der Nanopartikel verbessern, damit sie die richtigen Zellen erreichen.
- Wirksamkeitsfenster und Sicherheit: Wie stabil ist die Wirkung gegen verschiedene Virenstämme und -familien? Wie oft kann man die Abwehr „aufladen“, ohne dass es zu übermäßigen Entzündungen kommt?
- Interessenkonflikte und geistiges Eigentum: Patentanmeldung für Kombination 10 ISG (Icahn School of Medicine am Mount Sinai) und Beteiligung des Autors am Startup Lab11 Therapeutics.
Kontext: Warum „funktioniert“ es überhaupt auf diese Weise?
Bei Menschen mit ISG15-Mangel zeigen Zellen ein verstärktes Interferon-Reaktionsprogramm und keine erhöhte Anfälligkeit für Viren (im Gegensatz zu Mäusen). Diese Beobachtungen bildeten die Grundlage der Hypothese: Durch moderates und kurzzeitiges Aktivieren des „Kerns“ des Interferonschutzes (10 ISG) ist es möglich, eine universelle Barriere ohne chronische Entzündung zu erreichen.
Wie geht es weiter?
Die Autoren bezeichnen die Technologie als einen Kandidaten für die „Anfangstage“ der nächsten Pandemie – als universellen Schutz, während weltweit gezielte Impfstoffe und Medikamente entwickelt werden. Die unmittelbaren Schritte bestehen darin, die Verabreichung zu optimieren, die Toxikologie und die Dauer des Schutzes zu bewerten und anschließend erste Studien am Menschen zu diskutieren. Für eine großflächige Anwendung sind unabhängige Replikationen und ein regulatorischer Dialog erforderlich.
Quelle: Artikel in Science Translational Medicine (13. August 2025) und Pressemitteilung des Columbia University Medical Center. DOI: 10.1126/scitranslmed.adx57
