Neue Veröffentlichungen
Neues Nanopartikelsystem nutzt Ultraschall zur präzisen Arzneimittelabgabe
Zuletzt überprüft: 23.08.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
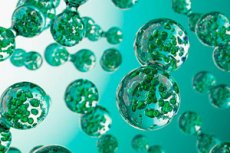
Die bedarfsgesteuerte Verabreichung klang lange Zeit wie ein Traum: Man spritzt ein Medikament ins Blut und aktiviert es genau dort, wo und wann die Wirkung benötigt wird. Das Team von Stanford und Partnern hat eine funktionierende Plattform demonstriert, die dies in einfacher und übersetzbarer Pharmasprache ermöglicht: akustisch aktivierte Liposomen (AAL), deren Kern mit Saccharose angereichert ist. Dieser sichere, weit verbreitete Arzneimittelträger verändert die akustischen Eigenschaften der Wasserfüllung des Liposoms, und gepulster Ultraschall niedriger Intensität lässt die Membran kurz „atmen“, wodurch eine Dosis des Medikaments freigesetzt wird, ohne das Gewebe zu erhitzen. Bei Ratten wurde Ketamin in bestimmten Bereichen des Gehirns und ein Lokalanästhetikum in der Nähe des Ischiasnervs „aktiviert“, wodurch die Wirkung an der richtigen Stelle erzielt wurde, ohne unnötige Nebenwirkungen.
Hintergrund der Studie
Die zielgerichtete Pharmakologie steckt seit langem in zwei Hauptproblemen: Wo soll das Medikament verabreicht werden und wann soll es aktiviert werden? Im Gehirn wird dies durch die Blut-Hirn-Schranke behindert, an peripheren Nerven durch das Risiko systemischer Nebenwirkungen von Lokalanästhetika und die „Ausbreitung“ der Blockade über das Gewebe. Wir brauchen ein Instrument, mit dem das Medikament auf dem üblichen intravenösen Weg verabreicht werden kann und das seine Wirkung dann punktuell – in wenigen Millimetern der gewünschten Hirnrinde oder um einen bestimmten Nervenstamm herum – und nur für die Dauer des Eingriffs einschaltet.
Physikalische „Fernsteuerungen“ für Medikamente wurden bereits erprobt: Licht (Photoaktivierung) ist durch die Eindringtiefe und Streuung begrenzt; magnetische und wärmeempfindliche Träger erfordern spezielle Geräte und oft eine Erwärmung des Gewebes, was die klinische Anwendung erschwert; Mikrobläschen mit fokussiertem Ultraschall können die Blut-Hirn-Schranke öffnen, doch geht dies mit Kavitation und Mikroschäden einher, die schwer zu dosieren und sicher zu standardisieren sind. Das andere Extrem bilden klassische Liposomen: Sie sind mit pharmazeutischen Technologien kompatibel und gut verträglich, aber zu stabil, um ohne starke thermische oder chemische Stimulation einen „Dosisimpuls auf Befehl“ abzugeben.
Daher das Interesse an akustischer Aktivierung ohne Erwärmung und Kavitation. Gepulster Ultraschall niedriger Intensität dringt tief ein, wird seit langem in der Medizin (Neuromodulation, Physiotherapie) eingesetzt, ist gut fokussierbar und skalierbar. Wenn der Träger so beschaffen ist, dass kurze akustische Impulse die Membrandurchlässigkeit vorübergehend erhöhen und einen Teil der Ladung freisetzen, ist ein „Drug Uncaging“-Modus – eine kontrollierte Freisetzung – ohne thermische Belastung und Ruptur der Gefäßwände möglich. Der entscheidende Unterschied liegt hier in der Zusammensetzung des Partikelkerns: Die akustischen Eigenschaften und die Reaktion auf Ultraschall hängen davon ab.
Und schließlich der „Translationsfilter“: Selbst brillante Physik nützt wenig, wenn die Plattform auf exotischen Materialien basiert. Für eine Klinik ist es entscheidend, dass der Träger aus GRAS-Komponenten zusammengesetzt ist, der Kältelogistik standhält, mit Massenproduktions- und Qualitätsstandards kompatibel ist und die Ultraschallmodi in die üblichen Bereiche medizinischer Geräte passen. Daher verlagert sich der Fokus nun auf „intelligente“ Versionen bereits bewährter Lipidträger, bei denen eine kleine Veränderung der inneren Umgebung (z. B. durch sichere Hilfsstoffe) das Liposom in einen „EIN“-Knopf für Ultraschall verwandelt – mit potenziellen Anwendungen von der punktgenauen Anästhesie bis zur gezielten Neuropsychopharmakologie.
So funktioniert es
- Ein Puffer mit 5 % Saccharose wird in das Liposom gegossen: Dies erhöht die akustische Impedanz und erzeugt einen osmotischen Gradienten, der die Freisetzung von Molekülen bei Einwirkung von Ultraschall beschleunigt.
- Fokussierter Ultraschall (ca. 250 kHz, Arbeitszyklus 25 %, PRF 5 Hz; maximaler Unterdruck im Gewebe ~0,9–1,7 MPa) wird auf den Zielbereich angewendet und das Liposom „öffnet“ sich – das Medikament wird freigesetzt.
- Ein wichtiges Detail: Es ist keine Erwärmung erforderlich (bei 37 °C ist die Wirkung sogar noch höher, es funktioniert aber auch bei Raumtemperatur), und der „Zucker“-Ansatz selbst verwendet GRAS-Hilfsstoffe und Standardprozesse zur Liposomenproduktion.
Was genau wurde gezeigt
- In vitro: Die Plattform arbeitet mit vier Medikamenten gleichzeitig:
- Ketamin (Anästhetikum/Antidepressivum);
- Ropivacain, Bupivacain, Lidocain (Lokalanästhetika).
Die Zugabe von 5–10 % Saccharose im Inneren ergab eine Freisetzung von ~40–60 % pro Minute bei Standard-Ultraschallbehandlung; 10 % ist stärker, hat aber eine schlechtere Stabilität, daher liegt das Optimum bei 5 %.
- Im Gehirn (ZNS): Nach intravenöser Infusion von SonoKet (Ketamin bei AAL) erhöhte Ultraschall im mPFC oder retrosplenialen Kortex die Medikamentenkonzentrationen an der Zielstelle im Vergleich zur kontralateralen/Scheinkontrolle und induzierte elektrophysiologische Veränderungen ohne Gewebeschäden. Es gab keine BBB-Öffnung oder Hinweise auf eine Kavitationsverletzung.
- Bei peripheren Nerven (PNS): Die SonoRopi-Formulierung (Ropivacain bei AAL) mit externer Bestrahlung des Ischiasnervbereichs führte zu einer lokalen Blockade auf der behandelten Seite, ohne EKG-Veränderungen und ohne histologische Schäden im Gewebe.
Zahlen zum Merken
- Ultraschallparameter: 250 kHz, 25 % Einschaltdauer, 5 Hz PRF; im Gehirn ~0,9–1,1 MPa, In- vitro -Tests bis zu 1,7 MPa; Expositions-„Fenster“ – 60–150 s.
- Stabilität: Bei 4 °C behielten AALs ihre Größe/Polydispersität für mindestens 90 Tage (DLS ~166–168 nm, PDI 0,06–0,07).
- Kernphysik: Die „Öffnungskraft“ ist linear zur akustischen Impedanz der inneren Umgebung (Korrelation r² ≈ 0,97 für äquiosmolare NaCl/Glucose/Saccharose-Puffer).
Inwiefern ist dies besser als frühere „Ultraschall“-Träger?
- Frei von PFCs und Gasblasen: geringeres Risiko von Kavitation und Instabilität.
- Ohne Erhitzen des Gewebes: Keine „schweren“ Temperaturbedingungen oder Schmuckanforderungen an die Ausrüstung erforderlich.
- Venöser Weg, Standardpharma: Größe ~165 nm, bekannte Lipidkomponenten und Saccharose als Schlüssel zur akustischen Empfindlichkeit.
Warum braucht die Klinik das?
- Neuropsychiatrie: Ketaminähnliche Moleküle sind wirksam, weisen aber eine hohe Nebenwirkungsrate auf. Die gezielte Behandlung von mPFC/anderen Regionen würde theoretisch Effekte mit geringerer Dissoziation/Sedierung/sympathomimetischen Effekten hervorrufen.
- Schmerzlinderung und Regionalanästhesie: Die sonogesteuerte Nervenblockade ist „stark wirksam, hat aber wenig systemische Auswirkungen“ und verspricht eine geringere Kardio- und ZNS-Toxizität.
- Eine Plattform, kein Einzelfall: Der Ansatz ist auf andere Liposomen/polymere „flüssig-nukleare“ Träger und möglicherweise auf eine Vielzahl von Medikamenten übertragbar.
Wie steht es um Sicherheit und Pharmakokinetik?
- Bei Ratten war die Histologie des Gehirns/Endgewebes ohne Schäden, bei Experimenten mit „schlechten“ Parametern kam es zu Mikroblutungen, allerdings nicht im Arbeitsmodus.
- Im Blut wurden in den parenchymatösen Organen mit AAL mehr Metaboliten und weniger nicht metabolisiertes Arzneimittel beobachtet, was mit der Aufnahme/Metabolisierung von Partikeln durch die Leber zu Beginn und der Freisetzung an die Ziele während der Beschallung übereinstimmt.
Wo ist hier der „Löffel der Skepsis“?
- Dies ist eine präklinische Studie an Nagetieren; die Leberaufnahmekinetik und die Basis-„Leckage“ ohne Ultraschall müssen optimiert werden.
- Die Übertragung auf den Menschen vereinfacht die Stoffwechseldetails (geringerer Leberblutfluss), eine Bestätigung der Sicherheit/Dosimetrie ist jedoch zwingend erforderlich.
- Die Auswahl von Ultraschallmodi und Hilfsstoffen (die die Akustik stärker verändern, aber die Stabilität nicht zerstören) ist die Aufgabe der nächsten Arbeitsreihe.
Abschluss
Die „Zuckerfüllung“ der Liposomen macht Ultraschall zu einem „Ein“-Knopf für Medikamente, statt zu einem groben „Vorschlaghammer“. Dadurch kann das Medikament lokal – in Millimeterzonen des Gehirns oder entlang eines Nervs – aktiviert und im Rest des Körpers deaktiviert werden. Das ist keine Zauberei, sondern akustische und osmotische Technik – und den Ergebnissen nach zu urteilen, steht es kurz davor, ein Routineinstrument der zielgerichteten Pharmakologie zu werden.
Quelle: Mahaveer P. Purohit, Brenda J. Yu, Raag D. Airan, et al. Akustisch aktivierbare Liposomen als translationale Nanotechnologie für zielgerichtete Arzneimittelabgabe und nichtinvasive Neuromodulation. Nature Nanotechnology (veröffentlicht am 18. August 2025, Open Access). DOI: 10.1038/s41565-025-01990-5.
