Neue Veröffentlichungen
Fasten kann durch Veränderung des Darmmikrobioms bei der Behandlung von Typ-1-Diabetes helfen
Zuletzt überprüft: 23.08.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
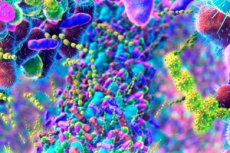
Bei Autoimmundiabetes Typ 1 (T1D) geht es um mehr als nur Insulin und Blutzucker. Immer mehr Belege bringen das Darmmikrobiom mit dem Risiko, dem Verlauf und der damit verbundenen Entzündung von Autoimmunerkrankungen in Verbindung. Die Ernährung ist eine der schnellsten Möglichkeiten, die Mikrobiota zu optimieren. Daher ist das Interesse am therapeutischen Fasten natürlich: Es hat bereits die Zusammensetzung von Mikroben und Immunschaltkreisen bei gesunden Menschen und bei einer Reihe von Autoimmunerkrankungen verändert. Aber wie genau das Mikrobiom von Menschen mit T1D auf das Fasten reagieren würde, war bisher unklar. Eine neue Studie in Frontiers in Endocrinology schließt einen Teil dieser Lücke und zeigt, dass eine Woche medizinisch überwachtes Fasten die Mikrobiota bei T1D dramatisch und kurzzeitig umstrukturiert. Diese Veränderung bringt sie näher an das Profil gesunder Menschen heran – und überraschenderweise teilweise Überschneidungen mit dem gibt, was bei einer anderen Autoimmunerkrankung, Multipler Sklerose (MS), zu beobachten ist.
Hintergrund der Studie
Diabetes mellitus Typ 1 (T1DM) ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die β-Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört. Schätzungsweise 9 Millionen Menschen weltweit leiden darunter. Neben der Genetik beeinflussen Umweltfaktoren das Risiko und den Verlauf von T1DM erheblich. In den letzten Jahren ist das Darmmikrobiom zu einem der wichtigsten „Verdächtigen“ geworden: Bei Menschen mit T1DM unterscheiden sich Zusammensetzung und Funktionen von denen gesunder Menschen, und Veränderungen der Mikrobiota wurden bereits vor Ausbruch der Krankheit beschrieben. Häufiger werden eine erhöhte Darmdurchlässigkeit und eine Verschiebung von Metaboliten beobachtet, die die Immunität beeinflussen (kurzkettige Fettsäuren, Vitamin-A-Derivate, Tryptophan usw.). All dies passt zu der Annahme, dass die „Darmökologie“ die Immunantwort und den Verlauf der Autoimmunität beeinflussen kann.
Die Ernährung ist der schnellste Hebel zur Beeinflussung der Mikrobiota, daher wächst das Interesse an therapeutischem Fasten und „postmimetischen“ Ansätzen. In Modellen und gesunden Freiwilligen restrukturieren längere Nahrungspausen die mikrobielle Zusammensetzung, und in Tierversuchen reduzierten wiederholte Zyklen einer „fastenähnlichen Diät“ den Pool autoaggressiver T-Zellen und unterstützten regulatorische T-Zellen; ähnliche Signale wurden auch in einem Modell für Multiple Sklerose beobachtet. Es blieb jedoch die Frage: Wie würde das Mikrobiom von Menschen mit Typ-1-Diabetes auf das Fasten reagieren und ob die zuvor in anderen Gruppen beschriebenen „mikrobiellen Signaturen“ des Fastens wiederholt auftreten würden.
Auch ein Sicherheitsaspekt spielt eine Rolle. Langfristige Diätbeschränkungen galten bei Typ-1-Diabetes aufgrund des Risikos von Hypo-/Hyperglykämie und Ketoazidose bisher als riskant. Es gibt jedoch zunehmend kontrollierte Sicherheitsdaten: Ausgewählte Patienten konnten das Ramadan-Fasten sicher absolvieren, und bei ärztlich überwachtem 7-tägigem Fasten wurden keine schwerwiegenden Nebenwirkungen, einschließlich einer diabetischen Ketoazidose, berichtet. Dies ermöglicht sorgfältige klinische Protokolle, deren Ziel nicht darin besteht, den Diabetes „auszuhungern“, sondern kurze, kontrollierte Interventionen zu untersuchen, um Mechanismen und mögliche adjuvante Effekte zu verstehen.
Vor diesem Hintergrund formuliert das Pilotprojekt von Frontiers in Endocrinology eine klare Hypothese: Wenn ein Mangel an Nährstoffsubstraten ein starker, krankheitsunabhängiger Treiber der Mikrobiota-Reorganisation ist, sollte eine einwöchige Fastenkur bei Typ-1-Diabetes ähnliche Veränderungen hervorrufen wie bei gesunden Personen und anderen Autoimmunerkrankungen. Im nächsten Schritt wird geprüft, wie reproduzierbar diese Veränderungen sind, wie lange sie anhalten und ob sie zumindest mit Veränderungen klinischer Parameter (Lipide, Blutdruck) einhergehen, um zu entscheiden, ob größere und längere Studien durchgeführt werden sollen.
Wie die Studie aufgebaut ist (wer, was und wann)
Die Pilotstudie umfasste 19 Erwachsene mit Typ-1-Diabetes (95 % Frauen) und 10 gesunde Kontrollpersonen. Alle unterzogen sich einer 7-tägigen Kur mit therapeutischem Fasten in einem stationären Setting (kein Krankenhaus, sondern unter Beobachtung): ~200 kcal/Tag durch Gemüsebrühen, Säfte und Haferbrühe; Wasser und Kräutertees – ohne Einschränkungen. Stuhl wurde gesammelt: an Tag 0 (vorher), Tag 7 (unmittelbar danach) und an Tag 150 (nach ~5-6 Monaten); die Zusammensetzung der Mikrobiota wurde mittels 16S-Sequenzierung beurteilt. Unabhängig davon fügten die Autoren eine Teilstichprobe aus der NAMS-Studie zu MS hinzu: 10 Patienten mit MS unterzogen sich einer zweiwöchigen Fastenkur im Abstand von 6 Monaten (dazwischen – ein tägliches Intervallfenster von 14 Stunden), die Ernährung während der Fastenphase betrug bis zu ~400 kcal/Tag.
Was sich in der Mikrobiota verändert hat – die Hauptsache
Der bemerkenswerteste Befund: Bei Patienten mit Typ-1-Diabetes zeigte die Mikrobiota nach dem Fasten einen „Sprung“ – laut Beta-Diversität hatte sich die Zusammensetzung am 7. Tag bereits dem Profil gesunder Menschen angenähert, während sich bei Kontrollpersonen das Gesamtmuster für dieselbe Woche statistisch kaum veränderte (wahrscheinlich aufgrund der kleinen Gruppe). Bis zum 150. Tag war der Effekt abgeklungen – ein stabiles „neues Gleichgewicht“ stellte sich nicht ein.
Bei der Aufschlüsselung nach Gattungen zeigten 21 Taxa unterschiedliche Veränderungen bei Menschen mit Typ-1-Diabetes nach dem Fasten. Obwohl die Kontrollgruppe eine geringere Signifikanz aufwies, war die Richtung der Verschiebungen dieselbe. Zum Beispiel:
- Abnahme: Agathobacter, Fusicatenibacter, Oscillospiraceae UCG-003;
- Wachstum: Escherichia/Shigella, Ruminococcus-Torques-Gruppe, Ruminococcaceae UBA1819.
Auf einer subtileren Ebene (ASV, „fast speziesspezifisch“): Nur in DM1 wuchsen Bacteroides vulgatus und eine der Prevotella, während in den Kontrollgruppen Roseburia intestinalis und eine Reihe anderer ASVs zurückgingen. Insgesamt bestätigt dies, dass Fasten einen kurzen, aber starken „Klick“ auf die Mikrobiota auslöst und die Details vom Ausgangsstatus abhängen.
„Hunger-Signatur“: Wiederholbare Veränderungen bei Typ-1-Diabetes, MS und gesunden Personen
Der Vergleich mit der MS-Gruppe ergab eine von der Krankheit unabhängige „Hungersignatur“ des Mikrobioms. Sieben Gattungen veränderten sich insgesamt in die gleiche Richtung: Agathobacter, Bifidobacterium, Fusicatenibacter und Lachnospiraceae UCG-001 nahmen ab, und Erysipelatoclostridium, Escherichia/Shigella, Eisenbergiella nahmen zu – und dies wird auch durch größere Studien an nicht-autoimmunen Populationen gezeigt. In der zweiten Phase zeigte MS eine hohe Reproduzierbarkeit: Etwa die Hälfte der signifikanten ASVs wiederholten sich in beiden Hungerwochen. Das Bild deckt sich mit der allgemeinen Biologie des Hungerns: „Pflanzenfaserliebhaber“ (viele Lachnospiraceae) nehmen ab, und Mucin- und Glykosaminoglykan-Zerstörer ( R. gnavus, R. torques, Hungatella ) nehmen zu und wechseln zu Wirtsressourcen; Eisenbergiella wird mit Ketose in Verbindung gebracht und könnte β-Hydroxybutyrat als Brennstoff verwenden.
Hat dies etwas mit Gesundheitsindikatoren zu tun?
Die Autoren verglichen die „bakteriellen“ Veränderungen mit Veränderungen klinischer Marker bei Typ-1-Diabetes und in der Kontrollgruppe. Nach Anpassung an Mehrfachvergleiche ergaben sich neun signifikante Assoziationen. Beispielsweise korrelierte Oscillospiraceae UCG-002 mit der Dynamik von LDL und in der Kontrollgruppe auch mit HDL und diastolischem Druck; das Wachstum von Erysipelatoclostridium (Kontrollen) und Romboutsia (Typ-1-Diabetes) ging mit einem Blutdruckabfall einher; Lachnospira „ging“ mit einem Abfall des Citratspiegels im Urin bei Typ-1-Diabetes einher. Es handelt sich hierbei um Korrelationen, nicht um Kausalitäten, doch sie stimmen mit der Literatur über den Einfluss einzelner Taxa auf Lipide und Gefäßtonus überein.
Wie passt dies in die Physiologie des Hungers?
Die Logik ist einfach: Bei einem Mangel an Nahrungssubstraten gewinnen Mikroben mit breiten Stoffwechselfähigkeiten und Zugang zu den Ressourcen des Wirts – Schleim (Mucin), Glykosaminoglykane, Ketonkörper. Daher verschiebt sich das Ökosystem beim Fasten auf natürliche Weise von aktiven Fermentern von Ballaststoffen ( Agathobacter und seine Verwandten sind große Butyratproduzenten, sie „lieben“ Ballaststoffe) zu „Generalisten“ und „Schleimfressern“. Ähnliche Veränderungen (einschließlich des Wachstums von Akkermansia ) wurden bereits nach 3- bis 10-tägigem Fasten in anderen Gruppen beschrieben; die aktuelle Arbeit zeigt, dass die Richtung bei Typ-1-Diabetes dieselbe bleibt.
Was bedeutet das für Menschen mit Typ-1-Diabetes?
- Es geht um das Mikrobiom, nicht um die „Behandlung von Diabetes“ durch Hungern. Die Veränderungen sind kurzfristig und betreffen vor allem die Zusammensetzung der Bakterien; eine stabile langfristige „Umstrukturierung“ über 5-6 Monate ist nicht zu verzeichnen.
- Sicherheit ist entscheidend. Ein siebentägiges Fasten bei Typ-1-Diabetes ist unter Überwachung möglich (in den Pilotstudien wurde keine DKA beobachtet), und es liegen Daten zur Sicherheit des Ramadan-Fastens bei ausgewählten Patienten vor. Dies ist jedoch kein Grund, zu Hause zu experimentieren – das Risiko einer Hypo-/Hyperglykämie und Ketoazidose ist real.
- Worin liegt der praktische Nutzen? Die Forscher nennen zwei Ansätze: (1) zu verstehen, welche Taxa mit einer Verbesserung des Blutdrucks und der Lipide in Zusammenhang stehen; (2) zu testen, ob sich das Hungergefühl durch „sanfte“ Ernährungsmaßnahmen (Essensfenster, Nahrungszusammensetzung) oder Probiotika/Präbiotika nachahmen lässt, ohne dass man eine ganze Fastenwoche einhalten muss.
Einschränkungen
Dies ist ein Pilotprojekt mit kleinen Gruppen; die wichtigsten Statistiken wurden von DM1 „gezogen“, die Signifikanz sank in den Kontrollgruppen ab. Methode: 16S (Taxonomie, nicht Funktionen); Virus/Mykobiom wurden nicht profiliert. Korrelationen mit klinischen Markern sind assoziativ; Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen spezifischen Bakterien und beispielsweise LDL müssen noch verifiziert werden. Und schließlich erwies sich der Effekt als vorübergehend – der „Abdruck“ des Hungers verschwindet innerhalb von Monaten.
Was sollte die Wissenschaft als nächstes tun?
- Größere RCTs mit klinischen Zielen (glykämische Variabilität, Blutdruck, Lipide), Multi-Omics (Metagenomik/Metabolomik) und Überwachung der Dauerhaftigkeit der Wirkung.
- Vergleich der Regime: Fastenwoche vs. Intervallfenster (z. B. 14–16 Stunden), ketogene Phase, „postmimetische“ Protokolle.
- Mikrobiota-Ziele: Testen, ob die „Hungersignatur“ bei Typ-1-Diabetes ohne striktes Fasten durch Ernährung/Nahrungsergänzungsmittel rekapituliert werden kann.
Quelle: Graef FA et al. Fasten führt zu Veränderungen der Darmmikrobiom-Signatur, die sich auf Patienten mit Typ-1-Diabetes erstrecken. Frontiers in Endocrinology, 13. August 2025. DOI 10.3389/fendo.2025.1623800
