Neue Veröffentlichungen
Chronische Infektionen im Fadenkreuz: Könnte ein Mikroorganismus Alzheimer verursachen?
Zuletzt überprüft: 09.08.2025

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.
Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.
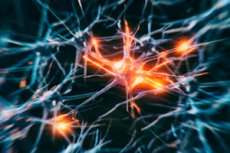
Wissenschaftler um Randy Brutkiewicz haben in der Fachzeitschrift Trends in Neurosciences eine Übersichtsarbeit veröffentlicht, die klare Kriterien und einen Leitfaden zur Bestimmung bietet, ob chronische Infektionen tatsächlich Alzheimer verursachen können. Der Artikel „Was wäre nötig, um zu beweisen, dass eine chronische Infektion die Ursache für Alzheimer ist?“ beantwortet eine seit langem diskutierte Frage: Reichen Zusammenhänge zwischen Mikroben und Alzheimer aus, um einen ursächlichen Zusammenhang nachzuweisen?
Warum ist das wichtig?
In den letzten Jahrzehnten haben sich zahlreiche Beobachtungen zum Nachweis verschiedener Mikroorganismen im Gehirn von Patienten mit AD angesammelt: Herpes-simplex-Viren (HSV-1), der bakterielle Erreger Porphyromonas gingivalis aus der Mundhöhle, Pilze und andere. Bisher hat jedoch keine Hypothese den Status einer bewiesenen Hypothese erlangt – hauptsächlich aufgrund des Mangels an soliden epidemiologischen und experimentellen Daten.
Vorgeschlagene Beweiskriterien
Die Autoren passen Kochs klassische Postulate an die modernen Realitäten neurodegenerativer Erkrankungen an und schlagen einen sechsstufigen Fahrplan vor:
Robuste Assoziation
– Auswahl großer Kohorten, bei denen das Vorhandensein des Mikroorganismus im ZNS (durch Biopsie oder Biomarker) zuverlässig mit frühen Stadien der AD korreliert.Zeitreihen
– Langfristige prospektive Studien zeigen, dass Infektionen der Gehirnzellen oder der Peripherie dem kognitiven Abbau vorausgehen.Biologischer Mechanismus
– Eine klare Beschreibung, wie ein bestimmter Erreger pathologische AD-Kaskaden auslöst: β-Amyloid-Aggregation, Tau-Protein-Phosphorylierung, chronische Neuroinflammation.Experimentelle Überprüfung
– In-vivo-Reproduktionsmodelle (z. B. transgene Mäuse), bei denen die Inokulation mit Krankheitserregern zu AD-ähnlichen Veränderungen und Verhaltensstörungen führt.Reversibilität der Pathologie
– Antiinfektiva oder Impfstoffinterventionen, die die Entwicklung der AD-Pathologie in präklinischen und klinischen Studien verhindern oder teilweise umkehren.Generalisierbarkeit
– Multizentrische randomisierte Studien mit unterschiedlichen Populationen und unterschiedlichen Infektionswegen (nasal, hämatogen, peripher) sollten vergleichbare Ergebnisse liefern.
Hauptherausforderungen
- Eine Reihe potenzieller Krankheitserreger: HSV-1, P. gingivalis, bestimmte Pilze und sogar „mikrobielle Quartette“ können beteiligt sein.
- Infektionsformen: latente Persistenz in Neuronen vs. periphere chronische Infektion mit Eindringen in das ZNS.
- Messwerte und Biomarker: Es bedarf standardisierter Methoden zum Nachweis von Krankheitserregern in Hirngewebe, Zerebrospinalflüssigkeit und Blut sowie zuverlässiger Signaturen der Neurobildgebung.
Autorenangaben
„Wir bestreiten nicht die wichtige Rolle von Alterung, Genetik und Stoffwechsel bei Alzheimer“, betont Randy Brutkiewicz. „Damit die Infektionshypothese jedoch als gesichert gilt, ist eine deutliche Stärkung der epidemiologischen und experimentellen Grundlagen erforderlich.“
„Das Hauptziel besteht darin, Neurologen, Mikrobiologen und Kliniker zusammenzubringen, um strenge, reproduzierbare Protokolle und Beweiskriterien zu entwickeln“, fügt Wei Cao, Co-Autor der Studie, hinzu.
Die Autoren heben die folgenden wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen hervor:
Die Notwendigkeit prospektiver Kohorten
„Nur Langzeitstudien, die die Infektion lange vor den klinischen Manifestationen der Demenz verfolgen, werden in der Lage sein, einen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Infektion und der Alzheimer-Krankheit herzustellen“, bemerkt Randy Brutkiewicz.Fokus auf biologische Mechanismen
„Es ist wichtig, genau zu verstehen, wie Krankheitserreger die β-Amyloid-Aggregation und Tau-Phosphorylierung auslösen – ohne einen klaren Mechanismus bleibt jeder Zusammenhang lediglich eine Korrelation“, fügt Wei Cao hinzu.Überprüfung in Tiermodellen
„Es werden standardisierte In-vivo-Modelle benötigt, wenn die Impfung mit einem bestimmten Erreger die AD-Pathologie und kognitive Defizite reproduziert“, betont Julia Kim.Klinische Studien zu Interventionen
„Wenn eine infektiöse Rolle bestätigt wird, wäre der nächste Schritt, Impfstoffe oder antimikrobielle Mittel zu testen, um das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit zu verhindern oder zu verlangsamen“, schließt Co-Autorin Maria Ramos.
Dieser Bericht liefert einen klaren Leitfaden für die Untersuchung der Rolle von Mikroben bei der Alzheimer-Krankheit und lädt die wissenschaftliche Gemeinschaft dazu ein, multidisziplinäre Forschungsanstrengungen zu koordinieren. Sollte sich die Infektionshypothese bestätigen, könnte dies die Ansätze zur Alzheimer-Prävention und -Behandlung radikal verändern – vom Frühscreening chronischer Infektionen bis hin zur Entwicklung antiinfektiöser Therapien und Impfstoffe.
